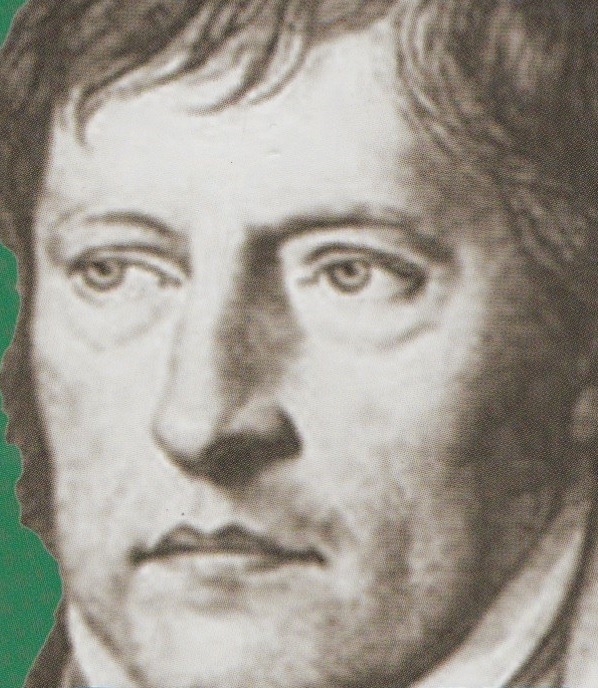A top
- aber[GDJW]I⦅並列;ただし文と文を結ぶ場合には必ずしも文頭に置かれず文成分間のいずれの箇所にも挿入される⦆1⦅矛盾・対照・対立:しばしば doch, dennnoch, nun などをを伴う⦆(英 :but)しかし,だが,けれども,ところが,それにしても,ただし,もっとも: 〖aber auchの形で先行の内容を強調して:→2 c】Du kommstt allein, ∼ auch ganz allein! 一人で来るんだぞそれもまったくひとりで来るんだぞ|2⦅文中でのアクセントなしで;話し手の主観的心情を反映して⦆c)⦅aber auch の形で;非難・不満を表して:→1⦆Das ist ∼; auch zu ärgerlich. そいつは〔それにしても〕ひどすぎるね.3⦅聖書・物語・論文などで aber の意味が薄れて単に接続を示して⦆すると、そこで、ところで:(☞auch,wohl)
- allein[GDJW]III⦅並列;文と文を結び,つねに文頭に置かれ,「矛盾・対照・対立」を示すが aber, doch, jedoch などより表現が強くまた文章語的⦆ (aber)しかしながら,ところが,しかるに,とはいえ:
- an[GDJW]I前⦅位置を示すときなどは3格支配,方向を示すときなどは4格支配.定冠詞 dem と融合して am, das と融合して ans となることがある⦆1⦅密着・密接・近接を示す⦆a)⦅空間的⦆⦅3・4格と⦆①⦅主として表面への⦆…〔の表面〕に,…〔の表面〕にくっついて,…〔の表面〕に密着して,…〔の表面〕に沿って〈を伝わって〉:②⦅主として側面への⦆…〔の側面〕に接して,…のかたわらに〔接して〕,…のほとり〈そば〉に,…のそばを通って:☆「そばに・かたわらに」を表す前置詞には他に neben と bei があるが,どちらも an とちがって密着・密接の意味を持たず,neben は並列的隣接を,bei は漠然たる近接を示す.したがって「〔暖炉の〕火のそばに座る」は、sich4 ans Feuer setzen であって sich4 neben das Feuer setzen ではなく,「だれだれのわきに座る」は,sich4 neben jn. setzen であって sich4 an jn. setzen ではない.また,bei jm. sitzen は前後左右を限定せずにただ「…のそば〈近く〉に座っている」ことを示す.b)⦅密着の意味から,付属物・属性などの本体・持ち主を示す⦆⦅3格と⦆…の,…に付属し〈備わっ〉ている,…には,…における〈おいて〔は〕〉:
- außer[GDJW]I⦅3格支配,ただし運動の方向を示すときは4格を支配することもある:→1⦆1(außerhalb)…の外で〈に〉,…の外部で〈に〉:〖3格と〗∼ sich3 sein(喜び・不安・怒りなどのために)我を忘れている‖みずからの道を外れてゐる2 a)⦅除外⦆(ausgenommen)…を除いて,…以外には:(☞Aussersichseyn)
B top
- bei[GDJW]I⦅3格支配.古くは方向を示すときには4格支配もあった:→★:定冠詞 dem と融合して beim となることがある⦆1⦅近接・近傍を示す.ただし an と異なってふつう密着・密接の意味を持たず, neben と異なってかならずしも並列的隣接に限定されない:→an I 1 a ☆⦆a)⦅空間的;ただし方向は示さない⦆…の近く〈近傍〉で〈の〉,…のそば〈かたわら〉で〈の〉:2⦅近接・近傍の原義を失って,単に場所・場を示す⦆b)⦅空間性が希薄になって,もっぱら比喩的に場を示す⦆…には,…では,…のものに〈で〉は,…において〈あって〉は,…については,…に関していえば:〖bei sich3 の形で〗nicht 〔ganz〕 ∼ sich3 sein 正気でない,ぼんやりしている|3⦅密着・接触を示す.an で言いかえられる場合が多い:→an I 1, 5⦆a)⦅密着・接触⦆…に,…について〔の〕,…に接して〔の〕,…に至るまで:
[GRIMM]Bei und an, bei und zu berühren und vertreten sich oft, wer bei dem berge, steht auch an dem berge; die stadt liegt am Rhein, beim Rhein; setze dich bei mich ist was setze dich zu mir; ich führe das kind bei der hand, an der hand; dem ab, von der hand sind entgegengesetzt bei der hand, an der hand, zu der hand; die reihe ist nun an mir, bei mir; man spannt die pferde an einander, bei einander, zu einander. Nur ist, wer genauer zusieht, die nähe von an und zu stärker und gerader, als die von bei, in bei liegt ein neben, zur seite, im umkreis, circa: der an das feuer gehende berührt es mit seinen füszen, der zu dem feuer gehende geht unmittelbar darauf los, ohne es schon erreicht zu haben, der bei das feuer gehende naht sich von der seite;
I. Bei, die praeposition. an ist gerecht für den acc. wie den dat., nachdem es nahen oder bleiben (bewegung oder ruhe) ausdrückt. auch bei regiert beide casus, zu hingegen für nahen oder bleiben allein den dat. statt des bei der ruhe hatte die alte sprache oft den instrumentalis.
B. bei des bleibens. 1) das verbum substantivum mit bei. des unterschieds zwischen béi sich sein und bei sích sein wurde vorhin gedacht:
2) jenem gehen, kommen, stellen, legen, setzen mit bei und dem acc. gegenüber gilt ein anlangen, stehen, liegen, sitzen, schlafen, ruhen mit bei und dem dativ, fühlbar hat bei etwas persönlicheres als an oder zu; stehen, liegen, sitzen bei mir kann nicht überall mit an mir und nirgends mit zu mir tauschen. du sitzest zu mir würde aussagen du näherst dich mir; du stehst, sitzest an mir müste durch hinzugefügtes nahe oder dicht deutlicher werden und käme dann auf eins heraus mit bei mir. vor sachen mögen bei und an wechseln: der arzt sitzt an oder bei dem krankenbette, aber nicht an, nur bei dem kranken;
[PAUL]1 Präp.1.1 Urspr. nur mit Dat. und Ruhelage bezeichnend. In eigentlichstem Sinn drückt es räumliche Nähe aus. Es knüpft sich öfters noch ein speziellerer Sinn daran: ich bin bei ihm gewesen. d.h. in seinem Haus, waas man sogar sagen kann, wenn man jemanden nicht getroffen hat.
傍らに(接する・控える)
- bei[GDJW]I⦅3格支配.古くは方向を示すときには4格支配もあった:→★:定冠詞 dem と融合して beim となることがある⦆1⦅近接・近傍を示す.ただし an と異なってふつう密着・密接の意味を持たず, neben と異なってかならずしも並列的隣接に限定されない:→an I 1 a ☆⦆a)⦅空間的;ただし方向は示さない⦆…の近く〈近傍〉で〈の〉,…のそば〈かたわら〉で〈の〉:2⦅近接・近傍の原義を失って,単に場所・場を示す⦆b)⦅空間性が希薄になって,もっぱら比喩的に場を示す⦆…には,…では,…のものに〈で〉は,…において〈あって〉は,…については,…に関していえば:〖bei sich3 の形で〗nicht 〔ganz〕 ∼ sich3 sein 正気でない,ぼんやりしている|3⦅密着・接触を示す.an で言いかえられる場合が多い:→an I 1, 5⦆a)⦅密着・接触⦆…に,…について〔の〕,…に接して〔の〕,…に至るまで:
D top
- da[GDJW]II 1⦅〔主文に先行する〕原因・理由を表す副文を導く,しばしば副詞 ja, doch, nun, 〔nun〕einmal などを伴う⦆(英:as)(なんといっても実際に・現に)…なので,…だから,…であるからには,…である以上は:
2⦅相反・譲歩の副文を導く;ふつう副詞 doch を伴う⦆(wärend)…であるのに,…ではあるけれども,…でありながら:
[GRIMM]
15. abgeleitete bedeutungen. a. da für weil, doch minder nachdrücklich, die lage der dinge bezeichnend. (...)
〔後続事例〕er kann zuletzt sich nicht entbrechen,
da sie nichts sagt, ihr selbst davon zu sprechen
Wieland. - darum[GDJW]2⦅接続詞的に⦆(deshalb)それゆえに,だから:
- daß[GDJW]II 2⦅従属接続詞と⦆∇außerdem ~ …ということに加えて,…というばかりでなく|(☞daß II 2)
- Nicht daß[GDJW]nicht(ex.) Nicht daß ich wüßte! 私が知るもんか!
- da[GDJW]II 1⦅〔主文に先行する〕原因・理由を表す副文を導く,しばしば副詞 ja, doch, nun, 〔nun〕einmal などを伴う⦆(英:as)(なんといっても実際に・現に)…なので,…だから,…であるからには,…である以上は:
2⦅相反・譲歩の副文を導く;ふつう副詞 doch を伴う⦆(wärend)…であるのに,…ではあるけれども,…でありながら:
[GRIMM]
G top
- gegen[GDJW]I前⦅4格支配.古くは3格支配.方言では3格支配や2格支配もみられる⦆1(英:towards)a)⦅空間的に⦆…に〔向かって〕,…の方へ:2(英:against)a)⦅空間的⦆(wider)…と逆方向に,…に逆らって:b)⦅敵対・反対⦆…に反抗〈対抗〉して,…に対して;(↔für)…の不利益になるように,…の反対側に立って:反逆する
- gegenüber[GDJW]I前⦅3格支配:後置されることが多く,人称代名詞を支配するときはつねに後置⦆1⦅空間的⦆…の向かい側に,…と向かい合わせに:2⦅関係⦆…に対して〈向かって〉,…の〔面〕前では;…に直面して:3…に比べて:対向して
H top
- hinter[GDJW]I⦅位置を示すときなどは3格支配,方向を示すときは4格支配;口語調では定冠詞 dem と融合して hinderm, den と融合して hintern, das と融合して hinters となることがある⦆1⦅空間的⦆(英:behind)(↔vor)…の後ろ〈背後〉に,…の裏手に,…の向こうに,…の奥に,…の陰に,…の内側に:
I top
- indem[GDJW]I 1⦅手段・方法⦆(dadurch, daß ...)…することによって,…して,…という形〈やり方〉で:〖理由・原因の意味が加わって〗(ex.)Indem ich ihm widersprach, hatte er großen Ärger. 私が彼に反論して〈反論したので〉彼はひどく腹を立てた|
- I 2⦅同時⦆(während)…しながら,…している間に:
- insofern[GDJW]II 1(falls)…の場合には:2…のかぎりでは、…という点
〈意味〉では:(☞insofern (adv.))
- indem[GDJW]I 1⦅手段・方法⦆(dadurch, daß ...)…することによって,…して,…という形〈やり方〉で:〖理由・原因の意味が加わって〗(ex.)Indem ich ihm widersprach, hatte er großen Ärger. 私が彼に反論して〈反論したので〉彼はひどく腹を立てた|
J top
- jedoch[GDJW]II⦅並列:矛盾・対立・対象を示す⦆(aber)しかし(→I☆i):(☞ jedoch I)
[GRIMM]
jedoch, conjunction des gegensatzes, aus doch mit vorangestelltem, eine bedingte behauptung oder eine bestreitung ausdrückendem je (sp. 2277) gebildet, in mehreren bedeutungen des einfachen doch angewendet.
1) wie doch 1 (theil 2, 1200) bestimmt auf den gegensatz hinweisend, ihn zurückdrängend, dennoch, demungeachtet, nichtsdestoweniger, tamen:
2) häufiger, und in der modernen sprache fast ausschlieszlich, wie doch 2 (theil 2, 1201) das entgegenstehende bestreitend, berichtigend, mäszigend, vermittelnd, wie aber, indessen:
- jedoch[GDJW]II⦅並列:矛盾・対立・対象を示す⦆(aber)しかし(→I☆i):(☞ jedoch I)
[GRIMM]
N top
- nachdem[GDJW]I 1⦅時間的先行;副文の時称にはふつう完了形を用い,主文より時間的に前であることが示される⦆…してしまってから,…したあとで:
- noch[GDJW]II接⦅ふつう weder … noch …, nicht … noch … などの形で否定詞として⦆(…でもなく)…でもなく:1⦅並列:語句と語句を結ぶ⦆2⦅副詞的;主語を同じくする文と文を結ぶ⦆
[GRIMM]
noch, conj. und nicht, auch nicht, und auch nicht.
2) im ersten gliede steht eine andere negation.
a) nicht, nie, kein u. s. w. mit nachfolgendem noch; goth. ni — nih, aber auch nih — ni:
nhd. nicht — noch (s. auch nicht III, 3, b), nichts — noch, nie — noch, kein — noch u. s. w.:
(☞noch副)
O top
- ob
[GRIMM]
ob, conjunction.
A. ob als condititional- und concessivpartikel.
4) das concessive ob wird im nhd. gern verstärkt durch die einräumenden adverbia auch, gleich, schon, wol, zwar, woraus durch zusammenrückung unsere concessiven (auch in verkürzten sätzen gebrauchten) conjunctionen obgleich, obschon, obwol, obzwar entstanden sind, die des zusammenhanges wegen gleich hier eingereiht werden (vgl. die concessiven wenn, wie mit nachfolgendem auch u. s. w.). gramm. 3, 286.
d) ob — wol, ob wol, obwol.
ob nun wol gott alle notturft .. bescheret, nicht destoweniger sehen wir, dasz. Albertinus narrenhatz 207;
(☞nun) - ob zwar[GDJW] ob2∇b)⦅auch, gleich, schon, zwar などを伴って譲歩文を導く:→ obgleich, obschon, obzwar⦆たとえ…であるとしても,…であるにもかかわらず:
- obwohl[GDJW]…にもかかわらず、…であるのに、…であるが:
- oder
[GDJW]1 b)⦅大差ないものを列挙して⦆①…ないしは…,…や…や:②…にせよ…にせよ,…と…のいずれにかかわりなく:… oder auch ……でなければ…でも,…かあるいはむしろ:☆oder で結ばれた主語に対応する定動詞の形はいちばん後ろの主語によって決まる:
c)⦅言いかえ・言い直し⦆言いかえると、すなわち;正確に言うと,…というよりむしろ:[ex.] Das ist falsch ~ 〔vielmehr〕 übertrieben. それは正しくないというよりもむしろ誇張されている.| Das Zimmer hat nur ein Fenster ~ eine Glastür. その部屋にはむしろガラス戸と呼んだ方がふさわしい窓が一つあるだけだ.|(☞gar, vielmehr) - ohne[GDJW]I前⦅4格支配⦆1⦅名詞はしばしば無冠詞⦆a)⦅欠如・非随伴⦆(英:without)(↔mit)(予期されているものを)伴わずに,…なしで〈に〉,…を欠いて,…を持たず(備えず)に,…付きでない,…を免れて,…しないで(→II):
- ob
[GRIMM]
S top
- so[GDJW]III2⦅従属的⦆a)⦅形容詞・副詞とともに構文を導いて⦆①⦅しばしば auch を伴って,譲歩・認容を示す⦆〔たとえ〕いかに…とはいえ(やはり):
[GRIMM]
B. conjunctionaler anwendung nahekommend.
2) syntactisch ungleichartiges verknüpfend, vor dem übergeordneten.
a) so als einleitung eines hauptsatzes, der durch einen (in der regel vorausgehenden) adverbialen nebensatz näher bestimmt wird. dieser allgemeine gebrauch eines völlig verblaszten so erklärt sich von so bei vergleichssätzen (s. oben A, 1, l) aus, für die entwicklung kommen aber auch die unter A, 1, a, β und B, 1 erwähnten anwendungen in betracht.
δ) nach einem conditionalen nebensatze, sich oft mit α berührend, so — so:
- solange[GDJW]I⦅従属⦆⦅継続する期間の限定を示す⦆…している〈…である〉あいだは,…している限り,…の期間は:
- sondern[GDJW]⦅並列⦆⦅先行する先行しと呼応して⦆(英:but)…ではなくて…:
[DUDEN]
dient nach einer verneinten Aussage dem Ausdrücken, Hervorheben einer Verbesserung, Berichtigung, einer anderen, gegensätzlichen Aussage; vielmehr; richtiger gesagt, im Gegenteil
[GRIMM]im ausgebildeten nhd. den gegensatz nach einem negierten satztheile einleitend. es ist an die stelle von sonder getreten.
1) in gewöhnlicher anwendung nach negation:
die negation steht bei einem nicht correspondierenden gliede: die starcken dürffen keines arztes, sondern die krancken.
2) nach nicht negierten satztheilen; nach sätzen, die sich in negierte umdenken lassen:
- sowie[GDJW]1⦅時間的に同時⦆(sobald)…するやいなや,…の瞬間に:2⦅他者との一致⦆…と同様に:3⦅並列的に und の重複をさけて⦆ならびに,および:(☞so wie)
- sowohl[GDJW]⦅並列⦆1⦅sowohl … als ⟨wie⟩〔auch〕 … の形で語句と語句(まれには文と文)を結んで⦆…と同様〔また〕…も,…も…も;…でもあり…でもある:
- so[GDJW]III2⦅従属的⦆a)⦅形容詞・副詞とともに構文を導いて⦆①⦅しばしば auch を伴って,譲歩・認容を示す⦆〔たとえ〕いかに…とはいえ(やはり):
[GRIMM]
U top
- um[GDJW]I 6⦅比較や変化における差異⦆b)⦅um so+比較級の形で;結果としての増減を示して⦆③⦅als, da, weil と呼応して⦆(…だから,…なので)それだけ〔逆に〕(ますます…):Dein Besuch freute mich ∼ so mehr, als ich dich nicht erwartet hatte. 君の来訪は予期していなかっただけに私にはいっそううれしかった.
- und[GDJW]⦅並列⦆1⦅〔同一品詞に属する〕⦆語と語,句と句を対等に並列してa)(英:and)…と…,…や…,および,並びに(略u.;記号&);(plus)〘数〙(…を)加えて,プラス(記号+):
und so fort(略 usf.)…等々:
und zwar(略 u. zw.)(先行の発言内容を限定または精緻化して)くわしく言うと;…しかも,…それも:
2 b) ③⦅先行する条件に対する結論を示して⦆そうなれば: [GRIMM]B. bedeutung und gebrauch. / mit unrecht sind seit dem 16. jh. der conj. und die verschiedensten und vielseitigsten bedeutungen zugeschrieben, so dasz sie zum knotenpunkt der ganzen syntax, zum exponenten fast aller nebensätze wurde und, mit geheimnisvollen kräften ausgestattet, die andacht zum unbedeutenden weckte.
II. die entwicklung der copula zur conjunction hat in der verknüpfung von verben ihren ausgangspunkt;
1) in hauptsätzen bevorzugen ahd. denkmäler wie Hildebrandslied, Wessobrunner gebet, Muspilli durchaus asyndeton Wunderlich 2, 404. 394. ähnlich das volkslied (Höber acta germ. 7, 1, 72).
das logische verhältnis der einzelnen sätze und satztheile zu einander ist in und dem keime nach, äuszerlich unbezeichnet, enthalten.
explicativ und begründend:
consecutiv:
adversativ:
temporal = und kaum:
concessiv:
f) ein mit und angefügter satztheil oder satz vertritt in der älteren sprache, mundart und umgangssprache oft einen infinitiv mit zu; die schriftsprache zieht diesen im allgemeinen vor. vgl. I 8. es handelt sich im vorangehenden satz um verba, substantiva, adjectiva und adverbia, die einer ergänzung bedürfen; meist erfolgt ein hinweis auf die folgende ergänzende bestimmung, und zwar durch ein anaphorisches pronomen oder durch so. die nicht auf unsere sprache beschränkte erscheinung hängt mit der abneigung der mündlichen rede gegen die unterordnung zusammen; sie geht von fügungen aus, in denen beide glieder als gleichgeordnet betrachtet werden können, zugleich aber die möglichkeit besteht, die zweite thatsache als ausflusz der ersten aufzufassen; dann mischen sich auch die syntaktischen formen.
- ungeachtet[GDJW]∇II⦅従属⦆(obwohl)…にもかかわらず:
- unter[GDJW]I前1 a) ➃⦅下属・支配下・圧政下⦆…の支配下で,
…のもとで,…におさえられて:…に服して
V top
- vermittels〔t〕媒介として[GDJW]前⦅2格,まれに3格支配:→laut II ☆⦆⦅雅⦆(mittels)…を手段として,…を用いて,…によって.:
- vor[GDJW]I前⦅位置を示すときは3格支配,方向を示すときは4格支配.俗語調では定冠詞 dem と融合して vorm, den と融合して vorn, das と融合して vors となることがある⦆1⦅空間的⦆(英:before)…の前に〈で〉:c)⦅比喩的に⦆①⦅3格と⦆…の立場から見ると: Vor dem Gesetz sind alle gleich. 法の前ではすべての人が平等だ| et.4 ∼ seinem Gewissen nicht verantoworten können 良心に照らすと…の責任は負いきれない.
W top
- weil
[GRIMM]
III. A. die entstehung der caus. conj. weil aus dem acc. der zeit die weile läszt sich an folgender beispielreihe veranschaulichen. auszugehen ist von zwei selbständigen hauptsätzen: 'der meister verliesz eine weile die werkstatt. die weile arbeitete der gesell lässiger'. mit ersparung des gemeinsamen satzglieds, inversion und schärferer betonung der gleichzeitigkeit wird ein zus.-gesetzter satz hergestellt: 'die weile, die der meister die werkstatt verliesz, arbeitete der gesell lässiger'. der relativsatz wird zum temporalsatz, die ihn einleitende formel zur conj., die aus inhaltlichen gründen (s. o. II) causalen sinn erhält: 'weil der meister die werkstatt verliesz, arbeitete der gesell lässiger'.
1) entwicklungsgeschichtlich steht somit der weil-satz voraus. diese urspr. satzfolge hat sich durchaus lebendig erhalten: [/] namentlich gilt vorausstellung, wo ein einleitendes eben die causalität schärfer heraushebt: eben weil der deutsche (hexameter) nur zum vorlesen bestimmt ist, darf sein gesetz weniger streng seyn A. W. Schlegel Athenäum 1 (1798) 47;
- wider[GDJW]I前⦅4格支配⦆1⦅雅⦆⦅対抗・反逆・反対⦆(〔ent〕gegen)…に対抗して,…に逆らって,…に反〔対〕して:
- wie[GDJW]II⦅従属;ただし複文でなく文成分を導くことも多い⦆5⦅時⦆(als)…するとすぐに,…したとき;…していると:6⦅主文中の語を受ける人称代名詞などを含んだ一種の関係文を作って⦆b)⦅様子・同時⦆
- wiewohl[GDJW]⦅雅⦆= obwohl
- weil
[GRIMM]
Z top
- zu[GDJW]前3 a)⦅動詞の不定詞にそえて zu 不定詞〔句〕をつくる⦆(英:to)…すること;…するという(…);…すべき;…するように:①⦅特定の動詞と結びついて一種の助動詞構文を作る不定詞句で;この場合不定詞句の前にコンマを置かない⦆〖sein+zu 不定詞句の形で;受動の可能・義務を表して〗
- zufolge[GDJW]前⦅普通後置され3格支配:前置されるときはふつう2格支配⦆1…の結果として、…のために、…に基づいて:2(nach)…に従えば、…によれば、…のいうところでは: