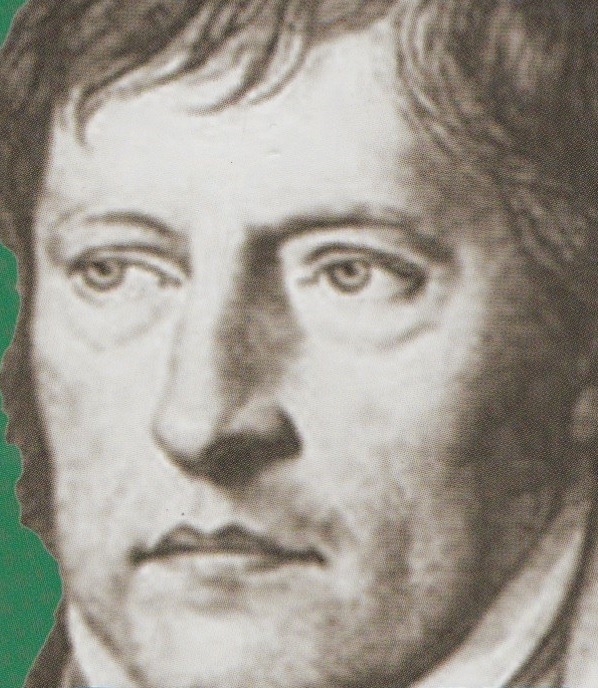A
- Abbild[GDJW]模写像;
模写、複写、写し、コピー;肖像、似姿:
- Aberglaube[GDJW]迷信;
(一般的に)盲信,思い込み,偏見:
- Abgrund奈落の底[GDJW](断崖・絶壁に画された)
深い谷間,深淵,奈落;⦅比⦆底知れぬ深み;破滅の淵;越えがたい溝:ex.) in den ~ stürzen 奈落の底に落ちる|[GRIMM]dann unermeszliche tiefe überhaupt:
abgrund des verderbens. Kant 6, 245; so dasz das all im abgrunde des nichts versinken müste. Kant 2, 477;
- Abhandlung論述[GDJW]1abhandlnすること.
- Abhängigkeit左右されること[GDJW]1⦅von jm. 〈et.3〉⦆(…への)依存
〈従属〉関係;〘哲〙依存,依属:(☞abhängig)
- Abnutzung(Abnützung)[GDJW]⦅ふつう単数で⦆(〔sich〕 abnutzen すること.例えば:)(使用による)損耗,摩滅;〘医〙消耗:
- Abscheu[GDJW]嫌悪の念,忌み嫌う気持ち:
- Abschnitzel付けたり[GDJW]⦅南部・オーストリア⦆削りくず;切れ端;(肉の)こま切れ:
[GRIMM]
das vorige.
- Absicht[GDJW]1意図,
こくろみ,計画:2(Hinsicht)見地,観点: in ∼ auf et.4…の点に関して;…のことを考えて〈考えると〉.…の見地からすると(☞vorsatz)
- Absolutheit絶対[GDJW]absolut なこと.
- Absonderung分離抽出すること[GDJW]1(〔sich〕absondern すること.例えば:)分離,
隔離,疎隔,隠匿;〖法〗(破産法で)別除する;〖化〗分離させる;〖地〗裂開させる;〖哲〗抽象する:(☞absondern)
- Abstraktion[GDJW]1抽象〔化〕,
抽象作用:2抽象的な概念:
- Abwesenheit[GDJW]1(↔Anwesenheit)不在、
欠席;欠如:
- Actio
[LDB]
Actio, ōnis, f. (von actum Supin. von ago)
II) Staats- oder gerichtlich Handlung,
2) vor Gerichte:
a) das Recht zu klargen,
b) die Klarge selbst,
c) die Rede vor Gerichte, die diese Klage unterstützt, Klagrede, oder Klage, oder Rede,
d) die Formel, deren sich der Kläger bedient, Klargeformel, wo auch zuweilen Klage gesagt wird,
e) die gerichtliche Vornehmung der Klagsache, der Termin,
(☞Akt)
- Actuosität現行態
[DCLF]
*ACTUôSITÉ, s. f. mot forgé par Pluche. "Après avoir imprimé à la matière l' actuôsité. ACUSABLE
ACUSABLE, ACUSATEUR, ACUSATION, ACUSER; Voy. ACCUSABLE, ACCUSER, etc. avec deux c.
[Antoine Pluche, Histoire du ciel, où l'on recherche l'origine de l'idolatrie, et les méprises de la philosophie: sur la formation, & sur les influences des corps célestes. Seconde édition, Tome Second, chez la veuve Estienne, Paris 1740, p. 136 f. "[V. Le monde d' Aristóte, les élément des Péripatéticiens.]" (Google, リヨン市立図書館)]
[136] Tâchons, je le veux bien, de rendre la physique concevable sans y faire intervenir l'action de Dieu, si la chose est [137] possible; & elle ne peut manquer de l'être, s'il est vrai que Dieu se soit déchargé sur une cause ministérielle du soin de ce bas monde; ou qu'après avoir imprimé à la matière l'entéléchie & l'actuosité, il se contente d'en voir éclore les effets, sans s'avilir par des opérations de détail.
(この部分は、第2版で追加された。)Cf. [Antoine Pluche, Histoire du ciel considéré selon les idées des poëtes, des philosophes et de Moïse. Où l'on fait voir : 1° l'origine du ciel poëtique, 2° la méprise des philosophes sur la fabrique du ciel & de la terre, 3° la conformité de l'expérience avec la seule physique de Moïse, Tome 2, chez la Veuve Estienne, 1739, p. 181 f. (Google, リヨン市立図書館 (Bibliothèque jésuite des Fontaines))]
[Nikolaus Hieronymus Gundling, Philosophische Discourse: Anderer Theil. Band 2: Cap. XI - XXI, Frankfurt a. M. und Leipzig 1740, Reprint, Georg Olms Verlag, 2016, S. 546." (Google, リヨン市立図書館)]
Dieses erfordert eine force d'esprit, eine grose actuositaet und attention, und bestehet darinnen, daß man die subtilissimas differentias sehen und separiren kan, quod sibi simile videtur.
[Johann Heinrich Lambert, "Über Methode die Metaphysik, Theologie und Moral richtiger zu beweisen", Aus dem Manuskript [1761] hrsg. v. Dr. K. Bopp, Kantstudien. Philosophische Zeitschrift, Ergänzungshefte im Auftrag der Kantgesellshcaft, Nr. 42, Verlag von Reuther & Reichard, Berlin 1918, S. 24" (Nr.38-42. Google, ノースウェスタン大学)]
Ob dieses aus dem Begriffe des Göttlichen Willens u. actuositaet gefolgert werden könne, ist eine andere Frage.
[Bruno Pinchard, "Vico ou la monade sublime, Philosophie et mythologie de la nature selon Leibniz et Vico", in: Martine de Gaudemar (ed.), La Notion de nature chez Leibniz: colloque. Studia Leibnitiana, Sonderheft 24, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1995, p. 233.]
III. Les puissances mythiques de l'actuosité spirituelle
[Jacques Colette, "La Phénomébikigue et l'être naturel. Apres Schelling et Cassirer: Merleau-Ponty et les formes symboliques", in: Oliver Bloch (ed.), Philosophies de la Nature, Sorbonne 2000, p. 434.]
Fasciné par ce que Husserl appellera l'énigme du monde
, pris dans le jeu de deux absolue, répugnant à l'idée d'une raison s'assurant transcendantalement d'elle-même à la manière de Fichte, Schelling se concentra sur le programme d'une « physique spéculative » — ce « spinozisme de la physique » — capable, compte tenu des acquis de l'idéalisme subjectif, de penser l'opérativité, l'actuosité de la natura naturans.
[André Doz, La logique de Hegel et les problèmes traditionnels de l'ontologie, Édition corrigé, Vrin, Paris 2007[1987], p. 164.]
Les traits relevés ci-dessus: unicité de la substance, nécessité de la position des accidents, et donc productivité ou actuosité
de la substance, ne sont pas immédiatement présents dans la catégorie traditionnelle de substance.
Dès lors, on peut aussi considérer que le thème spinoziste de l'actuosité
de la substance correspond à une radicalisation de la catégorie de substance, radicalisation qui ell-même radicalise le principe général d'une fécondité de la réalité. De la nécessité de la nature divine doivent suivre une infinité de choses en une infinité de modes (c'est-à-dire tout ce qui peut tomber sous un entendement infini).
[*26. Éthique, 1 Prop. 16."]
[Laurent Merigonde, "Etude critique de l'ouvrage de Alfredo Ferrarin, Hegel and Aristotle (Cambridge University Press, 2001)", in: Franck Fischbach (ed.), Hegel, avant et après, Kairos (Université de Toulouse-Le Mirail. Faculté de philosophie), Presses Univ. du Mirail, Toulouse 2004, p. 299.]
L'auteur insiste ici sur la nature neoplatonico-spinoziste[*]10 de la relecture de Aristote par Hegel, c'est-à-dire sur cun parti-pris d'unification conceptuelle, de différenciation, dans ce qui chez Aristote demeure posé sur la mode de l'indetité à soi, ou de la simple différence. Dés lors, la caractérisation du concept d'energeia par le concept de subjectivité impliquerait une forme de processus de différenciation identique à celui des formes de la subjectivité, de tell sorte que ces figures de la différence applleraient en creux le principe de leur unification, d'où naîtrait le besoin de système
. Il serait à cette fin nécessaire de remarquer le fait que l'activité requise pour penser un tel principe est le concept spinoziste de causa sui
, celui de l'actualité s'auto-produisant, ou précisément de l'actuosité.
[*]10Neoplatonic-spinozistic
, Ferrarin, p. 376. L'auteur insiste par ailleurs sur l'importance du concept d'actuosité, qui précisément apparaît au sein de la Science de la Logique en continuité avec l'évocation de Spinoza, en insistant sur le caractère efficient de la causalité.
- Affection感情[GDJW] Affektion∇2
好意,愛着;(Liebhaberei)愛好,道楽.[lat.]
[『羅和辞典』研究社]1作用,影響,感銘.2性質,状態.3気分,意向,意思.4愛好,愛着.5偏愛.
[カント『純粋理性批判』有福訳、熊野訳]触発
[Imman. Joh. Gerhard Schllers ausführliches und möglichst vollstädiges lateinisch-deutsches Lexicon oder Wörterbuch zum Behufe der Erklärung der Alten und Übung in der lateinischen Sprache in Fünf Bänden, 3 Aufl. Leipzig 1804] p.505.
AFFECTIO oder richtiger ADFECTIO, onis, f. (von adficio) die beschaffenheit, der Zustand einer Sache; 1) überhaupt, z. E. animi der Seele, ... 2) bedonders im Berhältnisse & zu einer andern, z. E. a) astrorum, ... die (astrologische) beschaffenheit der Gestirne, in so fern sie einen Einfluß auf die Menschen haben soll: daher der Einfluß einer Sache in die andre, das Verhältniß, die Verbindug, Beziehung auf &, ... b) animi die Beschaffenheit der Seele im Verhältnisse gegen die außern Gegenstände i. e. Gemüthszustand, Bewegung oder Neigung des Gemüths, Gesinnung & ... Daher die Liebe, Neigung, ... Daher adfectiones geliebte Personen, ...
[Wörterbuch der philosophischen Begriff, PhB500] S.16.
Affektion, lat. affectio ⟩Antun⟨ Einwirkung (dazu: ↑affizieren). R. Descartes nennt A. die Einwirkung der Gegenstände auf die Sinne (Les passions de l'âme, 1649, II. 1);desgl. bei I. Kant, darüber hinaus auch die Gegebenheitsweise von Gegenstänen für das Gemüt
[Le Dictionnaire de l'Académie française. Cinquième Édition. T.1 ( Smits , Paris , 1798 )]
AFFECTION. s. f. Amour. Sentiment qui fait qu' on aime quelque personne, qu' on se plaît à quelque chose. Tendre affection. Affection paternelle. Affection maternelle. Avoir de l' affection pour quelqu' un. Porter de l' affection à quelqu' un. Mettre son affection à une personne, à une chose. C' est le cadet qui est l' objet des affections de la mère. Il n' a d' affection pour rien. Il n' a affection à rien.
Il se dit aussi De l' ardeur avec laquelle on se porte à dire, ou à faire quelque chose par sentiment d' affection. Se porter à quelque chose avec affection, par affection. En parler d' affection.
☞Gefühl
- Aggregat[GDJW]1集合体,
凝集体:2〘数〙総計,総和:
- Akzidensアクシデント(偶有的なもの〉[GDJW]1(Zufall)偶発事;(Zufälligkeit)偶然〈偶発〉性;〘哲〙偶有性:
Accidenz[Adelung]
Das Áccidenz, des -es, plur. die Accidênzien, die mit einem Amte verbundenen zufälligen und ungewissen Einkünfte, im Gegensatze des gewissen Gehaltes, zufällige Amtsgebühren, Sporteln. Vom Lateinischen Accidens und Accidentia.
(☞akzidentell)
- Ahndung, Ahnung1予感,
予覚,(不確かな)予想;虫の知らせ,懸念:(☞ahnen)
- Akt手順[GDJW]1 c)〘法〙(法の)手続,審理:(☞actio)
- Aktivität能動態[GDJW]1 a)⦅ふつう単数で⦆能動〈主動〉性,
積極性,活動〈行動〉性;活発さ,活気,活力:(☞aktiv)
- in allem[GRIMM]
II. Bedeutung.
4) die bedeutung der ganzheit behauptet sich oft noch im sg. von all, zumal bei abstracten vorstellungen:
in allem, im ganzen, in summa
- Amt[GDJW]1 a)公職,
官職;(責任ある)役職,ポスト:b)職務,公務;職分,職責,任務;職権:
- Amtspflicht[GDJW]職務上の義務:
- Andacht祈り[GDJW]1
⦅単数で⦆a)信心深い〈敬虔な〉気持ち:b)思いを凝らすこと,気持ちの集中,三昧,瞑想:2(短い)祈祷,礼拝:
- ander[GDJW]⦅不定代名詞;格変化は形容詞に準じ後続する形容詞もふつう同じ変化:→★〔略〕⦆I⦅付加語的⦆1(英:other)同じ人〈事物〉でない:b)⦅定冠詞をともなわずに⦆(不特定のものの中で):もう一つ別の,これとはまた別の,ほかの,他の,別人〈他人の〉:II⦅名詞的;一般に中性単数で事物,そのほかは人を示す⦆1他〈別〉の人〈事物〉,もう片一方の人〈事物〉,残り;その他大勢;一般の人たち:2別種〈異質〉の人〈事物〉,これまでとは違う人〈事物〉:(☞anders )
- Anekdote[GDJW]逸話,
逸事,奇談:
- Anfangはじまり[GDJW](↔Ende)
はじめ,最初,発端;端緒,根源;始まり,開始,スタート║seinen ~ nehmen⦅雅⦆始まる:
- Angehörige[GDJW]2所属メンバー,構成員,
(団体の)一員:(☞Mitglied )
- Angabe跡づけること[GDJW]1 a)告げる〈述べる・挙げる〉こと,
言明;申し立て,主張;指図,指示;届け出,申告:(☞angeben )
- Angel中軸[GDJW]2(ドアなどの)
蝶番,ヒンジ;軸,心棒,旋回〈中心〉点;(刀などの)小身,中子:
- Anhang[GDJW]1(略Anh.)付属物;附録,
補遺;(手紙の)追伸,付箋;〘医〙付属肢,付随物,(特に:)虫垂;(Koda)〘楽〙結尾,付加曲:
- Anlage[GDJW]3素質,資質,(生まれながらの)
傾向,性向;天分,才能;〘生〙原基:
- Annahme引き受け[GDJW]2 a
受け入れ,受諾,応諾;承認;(動議などの)採決,可決,通過:3(Vermutung)推定;仮定,想定
- Annehmlichkeit[GDJW]⦅ふつう複数で⦆快適,
愉快;快楽:(☞angenehm)
- Ansehung[GDJW]1⦅官⦆顧慮:in ∼ et.2
…を顧慮して,…を考慮に入れて:
[GRIMM]
consideratio:
[DUDEN]
in Ansehung (veraltend: unter Berücksichtigung; angesichts: in Ansehung der Tatsache, dass …; in Ansehung seiner Verdienste)
- Ansicht[GDJW]1見方,
意見,見解:
- Anstoß[GDJW]2⦅比⦆(推進力としての)
突き,押し,衝撃,刺激,鼓舞,はずみ:
- Anstrengung酷使[GDJW](〔sich〕 anstrengen すること.例えば:)
努力,骨折り、苦労;緊張:Vgl. anstrengenI 1(能力などを)大いに働かせる,極度に緊張させる:2(神経・体力などを酷使して)疲れさせる:
- Anteil[GDJW]1 a)(当然手に入るべき)分け前,取り分;(関与すべき)割り当て分,負担(分担)分,持ち分:
- Antipode[GDJW]1(Ggenfüßler)対蹠者(地球上の正反対側の場所に住む人),
⦅比⦆(考え方・性格などが)正反対の人間:
- Anweisung[GDJW]1
命令,指示,指図:
- Anwendung[GDJW]
使用,応用,適用: ∼ finden 用いられる,使用される|
- Artあり方[GDJW]1 a)⦅ふつう単数で⦆
やり方,方式,流儀:b)⦅単数で⦆⦅話⦆本当のやり方,マナー,作法,礼儀:c)⦅ふつう単数で⦆性質,本性,気質:2(Spezies)〘動・植〙種(動植物分類の基本単位で Gattung の下位);(一般に)種類:
- die Art und Weise格好,性分,様相[GDJW] Art 1a)
やり方,方法|
[GRIMM] Weise
D. weise in formelhafter verbindung mit verwandten begriffen.
1) art und weise; seit dem 16. jh.; zunächst auch weise und art. als einheitlicher begriff zumeist eine erweiterung des einfachen weise, an die einzelnen bedeutungen von weise sich anschlieszend; doch mag bei manchen belegen (namentlich unter a) art mehr auf 'genus', weise mehr auf 'modus' zielen, eine bewuszte unterscheidung wird aber nur selten beabsichtigt sein. zu einer eigenbedeutung von art (vgl. teil 5, 572) gehört nur die in der umgangssprache geläufige redensart das ist keine art und weise im sinne von 'das gehört sich nicht', dafür auch das einfache das ist keine art.
a) im anschlusz an A 1 'haltung, verhaltensweise (= modus) eines menschen oder dinges und A 2 'art (= genus) eines menschen oder dinges' (selten); näher bestimmt durch attribut, genetiv, infinitiv, abhängigen satz:
b) im anschlusz an weise B 'die weise, wie etwas geschieht', mit näheren bestimmungen wie unter a:
c) im anschlusz an weise C mit präpositionen.
(☞Modus, weise)
- Aussersichseyn〈みずからの外にあること〉
- Assertion[GDJW]
主張,断言:
- Attribut[GDJW]1
本質的な性質、本来備わった特徴、特性、特質;〘哲〙属性:
- Aufopferung[GDJW]犠牲〔にすること〕;犠牲的
〈献身的〉行為:
- Aufwand[GDJW]1(金・努力などを)
費やすこと,消費:3浪費,ぜいたく:旧訳:消費(以後要注意)
- Augenblick[GDJW]1瞬間,
刹那;短時間,ちょっとの間:2(特定の)瞬間;(特定の)時点,時期;機会
- Augenschein[GDJW]1(確認のための)実見,
実地調査,〘法〙検証:
- Ausdruck[GDJW]1(英:expression)表現;(事柄を言い表す)
言葉;⦅ふつう単数で⦆話し方,文体:
- Ausführung現に成し遂げること[GDJW]1 a)⦅ふつう単数で⦆(計画などの)
実行,実現,履行,執行,実施,施行;〘劇〙上演:2⦅ふつう複数で⦆(詳しい)論述,叙述,説明,敷衍:
- Ausgeburt出来物[GDJW](特に悪い意味での)産物:[GRIMM]
fetus, gern in üblem sinn:
- Auskunft[GRIMM]
via, remedium, notitia
[DUDEN]Hilfsmittel, Ausweg
- Ausleberin
[GRIMM]
explicatrix.
[LS]
I. she that expounds or explains:
[LDB]
Expricatrix, icis, f. (von explico) Erkärerinn, deutliche Vorträgerinn, Cic. Acad. 1, 8.
[FHDW]
ausleger
2. allg.: ›j., der den Sinngehalt von etw. (z. B. eines Textes, Traumes, einer Begebenheit) erklärt, deutet, interpretiert‹; speziell: ›Astrologe, Sterndeuter; Wahrsager‹; vgl. auslegen 11.
3. ›Übersetzer, Dolmetscher‹; zu auslegen 12.
- Auslegung露出[GDJW]1
陳列,説明,解釈,註釈:[GRIMM]interpretatio:
wie theodicee soll auslegung der natur sein, sofern gott durch dieselbe die absicht seines willens kund thut. Kant 6, 149;
Cf.[LewisShort] interpretatioI. An explanation, exposition, interpretation (class.):
(☞auslegen, Exposition)
- Aussersichseynみずからの道を外れてゐること(☞außer)
- Äußerung外化表現[GDJW]1発言,
言葉,意見;(意見の)表出;〘言〙発話:2(気持などの)表れ,表現:(☞äußern)
- Ausstellung[GDJW]1⦅ふつう単数で⦆(ausstellen すること.例えば:)
陳列,展示;(文書・証明書などの)発行:(☞Exposition)
- Autorität[GDJW]1⦅単数で⦆権威,
威光,威信:
- Avancement[GDJW]⦅雅⦆(Beförderung)昇進,
昇級:
-
- Band紐帯[KS]⦅Ⅰ⦆①紐、帯、リボン、テープ、レース;(Ordens~)綬、勲章のリボン;…⦅Ⅱ⦆①つながり、きずな、縁(エニシ);
- Barbarei[GDJW]野蛮,
粗暴;残忍,非道;蛮行,暴力行為:
- Basis[GDJW]1(Grundlage)
基礎,土台,基盤,基底:
- Bedarf必需[GDJW]1必要〔量〕,需要;不足;:
- Bedeutung[GDJW]1(Sinn)(語・記号・象徴などの)意味,意味内容:(☞ Sinn)
- Bedingtheit条件態[GDJW]1⦅ふつう単数で⦆(bedingt なこと.例えば:)
制約,限定;関連〔性〕,相対性:2所与〈前提〉条件
- Bedingung[GDJW]1〔前提〕条件:
- Bedürfnis[GDJW]1 a欲求,
必要,欲望:
- Befriedigung[GDJW]2満足した状態,満足
(充足)感:
- Befugniß[GDJW]2
権限,権能,資格:
- Begebenheit[GDJW]⦅雅⦆(Ergeignis)出来事;
事件:
- Begierde[GDJW]
欲求,欲望;情欲:
- Behauptung[GDJW]1主張,
申し立て;〘数〙証明〔すべき〕命題〈定理〉:
- Behälter[GDJW]
容器,入れ物(箱・おけなど);貯蔵庫;(水・油・ガスなどの)タンク;(石炭などの)ホッパー;(Container)〘鉄道〙コンテナ:
- Behufため[GDJW]⦅官⦆(Zweck)
目的;(Erfordenis)必要:〖つねに前置詞 zu を伴って〗zu dem 〈disem〉 ∼〔e〕このために|
- beleg[GDJW]2(語彙・語法などの)典拠,出典,
使用例:
- Belieben[GDJW]⦅雅⦆好み;
意向:
- Bemerkung[GDJW](Äußerung)
発言,言葉;覚書,註釈,コメント:
- Bemühung[GDJW]⦅ふつう複数で⦆骨折り,
努力,尽力:
- Benehmen[GDJW]II 1(Betragen)
振舞い,態度,挙動,行動:
- Benehmung簒奪[GRIMM]
ereptio:
- Benutzung[GDJW]⦅ふつう単数で⦆利用,
使用:
- Berechnung[GDJW]計算,算出,算定,見積もり;⦅比⦆打算:(☞berechnen)
- Berechtigung正当化すること[GDJW]⦅ふつう単数で⦆
権利,権限,資格;正当さ,根拠,理由:
- Berücksichtigung[GDJW]1⦅単数で⦆
顧慮,考慮,斟酌,尊重:
- Berührung[GDJW]接触;
関係,交際;言及:
- Beschäftigung[GDJW]3∼ mit(仕事・問題などに)取り組むこと:(☞Geschäft)
- Beschaffenheit資質[GDJW]1性状,
性質:
[GRIMM] Beschaffenheitconditio, qualitas:
die wichtigkeit ist ein relativer begrif und was in einem betracht sehr unwichtig ist, kann in einem andern sehr wichtig werden. als beschaffenheit (qualification) unserer erkentnis ist dazu eine wahrheit so wichtig als die andere. Lessing 8, 211;
schade, dasz ich diese ernsthaftere antwort nicht so einleuchtend zu machen im stande bin. denn dieses zu können, müste schon das ganze werk des ungenannten der welt vor augen liegen, indem sich alle meine lobsprüche blosz und allein auf eine beschaffenheit (eigenthümlichkeit) desselben beziehen, aus einer beschaffenheit desselben entsprungen sind. 10, 216;
[GRIMM] beschaffen1) creare, schaffen, erschaffen:
2) schon mhd. drückte beschaffen und schaffen eine höhere ordnung und vorausbestimmung des schicksals aus, der sich die sterblichen fügen müssen:
4) mit etwas beschaffen, zurüsten, bewerkstelligen:
- Beschränkung[GDJW]1⦅単数で⦆制限,
局限:
- Besitz占有(物)[GDJW]1 a)(Eigentum)⦅集合的に⦆
所有物,財産;〘法〙占有物:2所持,所有;〘法〙占有:in den ~4 von et.3 kommen 〈gelangen〉 / et.4 in ~4 nehmen …を手に入れる|⇛占有取得する
- Besitzergreifung占有掌握
占有獲得[GDJW]入手,取得.
- Besitznahme占有取得[GDJW] = Besitzergreifung
- Bestehen[DUDEN]1.
das Vorhandensein
Synonyme zu Bestehen: Bestand, Dasein, Existenz, Leben
- Bett墓床[GRIMM]
8) wie der kirchhof das kühle bett, ein bett der todten, das schlachtfeld ein bett der gefallnen, strages, heiszen kann, sagen wir auch statt auf dem schlachtfeld, er ist auf dem bette der ehre gestorben:
im gegensatz zum krankenbett.
vgl. [GRIMM] ruhebett2) freier, wie ruhestätte:
besonders für die letzte ruhestätte, das grab:
Ihr Suchen mit den Fingern auf dem Bette, ist ein Vorboth, daß sie nun bald in diesem Bette werden ausgeruhet haben, und sich in das ruhigere Bette des Grabes hinbegeben werden.
(Predigten über das Leiden und Sterben Jesu an dem grünen Donnerstage, Charfreytage, und einigen Kreuzfesten, Hrsg. v. Modest Hahn, Augsburg 1791, (Google, BSB.) S. 58 f.)
「墓床」は業者用語の模様。出版辞書で管見調べ当らない。
- Bestätigung確証[GDJW]1確認,
立証,証明:
- Betätigung[GDJW]1活動,
行動:
- Betrachtung[GDJW]2考察,
考究,省察:
- Betragen[GDJW]
振る舞い,態度,挙動,行動;品行,行状:
- Beurteilung[GDJW]1
判断,判定;評価;批判,批評;〘哲〙価値判断:
- Bewährung実証力[GDJW]1(能力があることの)実証,
証明;確証:
- Bewandtnis特別の事情[GDJW]⦅ふつう単数で⦆
事情,状況:(ex.) Mit dieser Dame hat es eine ~. このご婦人にはある特別の事情がある。
- Beweggrund[GDJW]動機,
誘因:
- Bewunderung[GDJW](bewundern すること.例えば:)感嘆,
賛嘆,感服:(☞bewundern)
- Beziehung[GDJW]1⦅ふつう複数で⦆
交際,交わり,付き合い;関係,交渉;縁故関係,つて,コネ: zu ⟨mit⟩ jm. in ∼〔en〕 stehen …と関係がある|
- Beziehungslosigkeit関係を欠いたさま(あり方) Vgl. beziehungslos[GDJW]
関連のない,無関係の:
- Blase[GDJW]1泡,
気泡;水ぶくれ,火ぶくれ,まめ;〘医〙水泡,疱疹,丘疹:
- Blödsinnig馬鹿[GDJW]2
白痴〈精神薄弱〉の:[GRIMM]hebes, stupidus:
- Blendwerk[GDJW]1⦅雅⦆
まやかし,ペテン,▽ふしぎなできごと:
- Boden[GDJW]1 b)⦅単数で⦆(領域としての)
土地,領土,地盤:
- Brand放火[GDJW]1 a)火災,火事;燃えること,燃焼:[²DWB]
2 zerstörung, vernichtung von etwas, jmdm. mithilfe von feuer.
agewaltsames feuerlegen, brandstiftung, brandschatzen. gegenwartssprachlich selten und archaisierend:
- Bravour[GDJW]1⦅単数で⦆勇敢,
勇気:
- Brunnen[GDJW]1
井戸;噴泉,噴水;⦅雅⦆泉,わき水(→Bron1):
- Brutひよこ、稚魚[GDJW]2⦅集合的に⦆(ふつう卵生の)一腹のひな〈幼虫・子〉;⦅戯⦆(一家の)子供たち:
- Busch[GDJW]1(英:Bush)〔茂った〕
灌木〈低木〉;(低木の)茂み,やぶ:
C
- Charakter[GDJW]2⦅ふつう単数で⦆(事物の)性格,
性質,特性,特色,独特の持ち味,風味:
- Cocarde(☞Kokarde)
-
- Darstellung具現[GDJW]1(図・言葉などによる)
描写,描出,表現;作図:2(ある役を舞台で)演じること,演技:
- Dasein[GDJW]1 a)(Existenz)
存在,現存;〘哲〙(ヘーゲル哲学の)定有;(ハイデッガー哲学の)現存在:
- Degradation[GDJW]1格下げ,
降格,降等;〘カトリック〙聖職剥奪:
- Detail[GDJW]
細目,詳細〔図〕,細部,デテール;〘商〙小売り:
- Diebstahl[GDJW]1
盗み;〘法〙窃盗:
- Dienst[GDJW]1 a)勤務,服務,就業;職務,業務;〘宗〙礼拝,
勤行:2奉仕,尽力,世話,サービス:
- Dienstbarkeit[GDJW]1よく仕える〈尽くす〉こと、従順、恭順;雇われていること、従属;〘史〙隷属、臣従:2(Servitut)〘法〙地役権、
使用権:
- nur dies[GDJW]dies2 a)〖dies または dieses の形で先行文または後続複文の内容を受けて〗(ex.)Nur dies ist sicher, daß ... …ということだけは確実だ
- Differenz差異(のあること)[GDJW]1 a)〘数〙差,
余り:2意見の相違〈不一致〉;衝突,いさかい:[lat.](☞Unterschied)
- Dinteインク[GRIMM]
tinte,f. atramentum, ahd.
- Diremtion分割(☞dirimieren)
- Disposition自由処分,仕組み[GDJW]1⦅単数で⦆(Verfügung)
意のままにすること,任意の処理,自由な使用:3 a)編成,構成,組み立て;レイアウト:
- Drama[GDJW]
戯曲,劇,ドラマ;⦅ふつう単数で⦆〔悲〕劇的事件:
- Dunkelheit[GDJW]1
〔夕〕やみ;暗さ,黒さ,はっきりしないこと,あいまいさ,なぞ;難解さ;暗愚,無知:
- Durchgang[GDJW]1⦅ふつう単数で⦆(durchgehen1すること.例えば:)
通り抜け,通行,通過,透過:(☞durchgehen)
-
- ein[GDJW]II⦅不定代名詞:定冠詞を伴わず単独で用いるときも冠詞とは一部異なる変化をする⦆(英:one)1⦅定冠詞を伴わず単数のみ⦆b)⦅性の等しい名詞をうけて⦆一つ,一人,それ:〖複数2格の付加語と〗
III⦅基数:つねに強いアクセントを持つ⦆(英:one)2⦅名詞的に:変化は単独のときは不定代名詞と,冠詞などの後では形容詞と同じ⦆a)一人,1名,1個,一つのもの〈こと〉: Ich bin mit dir eins. 私は君と同じ考えだ| mit et.3 eins werden …と一致する|
[GRIMM]
C)übergänge ins pronomen.
1) seine kraft beginnt sich zu mindern, sobald andere genitive als zahlen, namentlich sobald pronominale von ihm abhängen, auf welche dann das gewicht der vorstellung samt dem hauptton überziehen kann. alles was sich mit dem pronomen verbindet pflegt pronominale geltung anzunehmen. in solchen fällen bleibt auch goth. ains, lat. unus, gr. εἷς stehen und der ursprüngliche zahlbegrif mag sich bald heben bald senken. sinkt er, so nähert er sich dem von quidam, quisquam.
b) folgt der gen. nach, so verbleibt dem ein mehr kraft:
c) den gen. vertreten praepositionen mit gleicher wirkung auf das zahlwort:
- Ehescheidungssache離婚事件[GRIMM]
- Ehre[GDJW]1(英:honour)名誉〔心〕;
誉れ,栄誉,光栄;礼遇:jm. die letzte ∼ erweisen⦅雅⦆…の葬儀に参列する|(☞erweisen)jm. keine Ehre machen 〈einbringen〉…にとって名誉にならない|
- Ehrgeiz[GDJW]1⦅ふつう単数で⦆
功名心,名誉欲,野心,やる気:
- Eid[GDJW]1(英:oath)宣誓,
誓約:
- Eigendünkel傲慢[GDJW]
うぬぼれ:[GRIMM]arrogantia, vana de se opinio:
- Eigennutz[GDJW]
私利〔私欲〕,利己心,エゴイズム:(☞eigennützig)
- ein[GDJW]III⦅基数:つねに強いアクセントを持つ⦆(英:one)2⦅名詞的に:変化は単独のときは不定代名詞と,冠詞などの後では形容詞と同じ⦆a)一人,1名,1個,一つのもの〈こと〉:
- einander[GDJW]⦅相互代名詞・無変化⦆(sich gegenseitig)(互いに)相手に〈を〉:
- Einbildung[GDJW]1想像,
幻想;幻覚:
- Einerleiheit一様態[GDJW]《雅》(einerlei なこと,例えば:)
同一性,普遍性.
- Einfallひらめき[GDJW]1(突然の)
思いつき,着想:[GRIMM]4) subita cogitatio, ein plötzlicher, schneller, kluger, guter, glücklicher einfall;
- einen Einfluß auf jn. ausüben 〈haben〉[GDJW] Einfluß1…に対して影響を及ぼす〈影響力を持っている〉:
- Einigkeit一体性[GDJW](意見の)
一致,合意;和合,協調;[GRIMM]unitas, concordia
- Einrichtung仕組み[GDJW]3⦅ふつう複数で⦆(公共機関の)
施設:
- Einwirkung[GDJW](einwirken すること.例えば:)作用,
影響:(☞einwirken)
- Einsicht[GDJW]2 b)洞察,
認識:
- Eintrag[GDJW]2⦅単数で⦆
損害,妨害:
- mit et3 eins werden[GDJW]III 2 a)…と一致する:
- Einteilung[GDJW]1
分配;区分,区画;目盛り;〘論〙区分,分釈,分班:
- Einzelner個別者[GDJW] einzeln1〖大文字で名詞的に〗(ex.) vom Einzelnen ins Ganze 〈zum Allgemeinen〉 gehen 細目より全体〈個別から全般〉へと進む.
- Eitelkeit[GDJW]1
虚栄心、自尊心,うぬぼれ:
- Elementエレメント[GDJW]1 a)
要素,因子,構成,分子:
- Elend[GDJW]1 a)
不幸,苦しみ,惨めな〈悲惨な〉状態:
- Emanation流出(エマナチオ)[GDJW]1 流出,
放散,放射.2〘哲〙エマナチオ:
- Empfänglichkeit受容態[GDJW]1(eimpfälich なこと.例えば)
受容力,感じやすさ,敏感さ,感受性:
- Empfindung[GDJW]1(Sinneswahrnehmung)感覚,
知覚;感性:
- Empörung[GDJW]1⦅単数で⦆
憤慨,憤激:(☞empören)
- Entfernung遠ざかること(距離)[GDJW]1距離,
隔たり:2 b)遠ざけること:c)離れること,離脱すること:(☞entfernen)
- Entgegengesetes対立したもの[GDJW]
逆の,正反対の:
- Entschluß[GDJW]
決心,決断:(☞entschließen)
- Entwicklung[GDJW]4展開,
発揮;例示,説明:
- Erbfeind[GDJW]1宿敵,
代々の敵,不倶戴天の敵〔民族〕 :
- Erdichtung[GDJW]2
作り事,虚構,作り話,フィクション:
- Erfinder[GDJW]1発明
〈案出・考案〉者;(一般に)発明家 :
- Erfindung[GDJW]1 a)⦅単数で⦆発明,
案出;着想 :
- Erkennbarkeit[GDJW]erkennbarなこと.(☞erkennbar)
- Erfolg[GDJW]成果,
結果;成功,上首尾,好結果,大当たり:
- Erfordernis[GDJW](特定の目的のために)
必要とされるもの;必要条件,要件:
- Ergebung[GDJW](sich ergeben すること.例えば:)2
服従;恭順;帰依;あきらめ :
- Erlaubnis[GDJW]⦅ふつう単数で⦆許可;(☞erlauben)
- Erreichung[GDJW]到達,達成:
- Erste[GDJW]最初:für die ∼ さしあたり(=fürserste)(☞erst)
[GRIMM]
erste, primus. die grundzahl und ordnungszahl der einheit rühren nicht aus demselben stamm her.
12) wie aus erst weitere adverbia entspringen (sp. 993. 994), bilden sie sich auch mit erste:
i) für das erste, pro primo: und das solt ir fur das erste wissen. 2 Petr. 1, 20. neuere schreiben bald fürs erste, bald vors erste. s. fürerst, vorerst.
(☞vorerst)
- Ertrag[GDJW]収益,
収穫;成果:
- Erwerb[GDJW]獲得,
取得,習得;獲得〈取得〉物;収益,所得:(☞erwerben)
- Erwerber[GDJW]獲得
〈取得〉者,買い手.
- Erwerbung[GDJW]1⦅単数で⦆獲得,
取得,購入.(☞erwerben)
- Erwiderung(Antwort)返答;
返報;しっぺ返し[GRIMM]erwiderung, erwiederung, f. entgegnung
1) remuneratio, vergeltung:
2) responsio:
- Erzeugung[GDJW]1生産,産出;製造:
- Erzogen教育[GRIMM] erziehen
4) educare, welches lat. wort, wie erziehen auf ziehen, auf ducere weist, nur dasz wir die starke form beibehalten, educare von educere abweicht. schon das einfache ziehen drückt auch alere, nutrire, τρέφειν aus, um so mehr erziehen, aufziehen.
e) abstractionen:
vgl. wol, gut, übel erziehen, unerzogen, non adultus verschieden von ungezogen, male educatus, moratus.
- es[GDJW]I⦅人称代名詞,3人称単数中性1・4格:2格 seiner [záinər](∇sein [zaɪn]),3格 ihm [iːm]; 所有代名詞 sein⦆ 1(英:it)⦅人称的⦆それ,これ,あれ;⦅人を表す既出の中性名詞を受けて⦆彼,彼女.b)⦅性・数にかかわりなく語や文の意味を受けて⦆それ,その人〔たち〕,そのこと.②⦅1格で:述語名詞や述語形容詞など,述語部分の代わりとして sein, werden, bleiben とともに⦆Ist er krank? — Ja, er scheint ∼ 〔zu sein〕. 彼は病気なのですか — ええそうらしいです|
- Essen[GDJW]
食事;宴会;食物,料理:
- Exemtion[GDJW]1〘法〙治外法権:
- Existenz現出(体)[GDJW]1⦅単数で⦆(↔Inexistenz)存在;生存、生活〔の基盤〕,生計〔を支える収入〕:2〘哲〙自覚存在,実存;[LEWIS] ex-sistō or existō stitī, —, ere,
to step out, come forth, emerge, appear:
- Expansion[GDJW]1〘理〙膨張:
- Exposition展示[GDJW]∇4(Belichtung)〘写〙露出.[DUDEN][frz. exposition < lat. expositio = Darlegung, Entwicklung]: 4. Ausstellung. Schau: 5. (Fot. selten) Belichtung.(☞Auslegung, Ausstellung)
-
- Fähigkeit[GDJW]1(…をする)
力,能力:
- Fall[GDJW]2 a)(英:case)場合,
事態,状況;事例;〘医〙症例(患者);〘法〙事件:
[GRIMM]
2) abstraction der sinnlichen vorstellungen.
e) es ist der fall, c'est bien le cas, es verhält sich so, dies ist gewöhnlich der fall;
- Faselei[GDJW]2
放心,注意力散漫;過失,落ち度;失敗,失策:
- Feder翼[GDJW]1 a)(英:feather)(鳥の)羽毛;羽飾り:
[GRIMM]
3) da trieb und kraft des fluges in den schwungfedern der flügel und des schweifes gelegen ist, so drückt auch feder häufig den flügel oder fittich aus. mhd. von einem ungeheuren thier:
- Fehler[GDJW]1 a)
誤り,間違い;過失,落ち度;失敗,失策:
- Feindschaft[GDJW](↔Freundschaft)敵意,
敵対関係:
- Festigkeit固定性[GDJW]
固いこと,固さ,堅固,堅実,ぐらつかないこと,一定していること,確固〔不動〕,安定,不変;断固としていること;緻密,目の詰まっていること:〘理〙剛性;〘工〙(材料の)強度,強さ;〘電〙抵抗〔力〕:
- Feuchtigkeit[GDJW]
湿り,湿気,水分,湿度:
- Fideikommiß[GDJW]〘法〙信託遺贈,
家族世襲財産:
- Finsternis闇[GDJW]1
暗黒,暗やみ;⦅比⦆暗黒の〈希望のない〉状態;無知蒙昧:
- Fleck[GDJW]2(Stelle)(特定の)場所,個所:(ex.) nicht vom Flock kommen 動かない;⦅比》進捗しない.
- Flecken[GDJW]1(市場のある)町(Dorf よりも大きい):
- Fliehkraft[GDJW](Zentrifugalkraft)遠心力.
- Foderung要請[GRIMM]
postulatio
- Foetura養育 Latin. noun sg fem voc, nom, abl of fetura[LS]
I.a bringing forth, bearing or dropping of young, a breeding (rare but class.).
- Folge順列,結論(結末)[GDJW]1 a)順番,
連続,継続;組,シリーズ,続き物,〔系〕列:(ex.) in alphabetischer (chronologischer)~ angeordnet アルファベット〈年代〉順に配列した|3(どちらかと言えば悪い)結果,効果;〘論〙帰結:(ex.)et.4 zur Folge haben 結果〔結論〕として…を伴う|(☞folgen)
- Folgerung論証[GDJW]
推論,推断,演繹;必然的な結果:
[GRIMM]argumentatio:
- Forderung[GDJW]1
要求,要請;命令;(権利の)主張:
- Form[GDJW]1 a)(英:form)形、
外形,外観;姿,容姿;型,形式,形態,方式;〘言〙語形,変化形;〘哲〙形相;〘聖〙様式(聖書の伝承素材の文学的形態):
[Adelung]
3. Die geformte oder gebildete Sache, doch nur in einigen Fällen.
- Fortgang[GDJW]2進行,
進捗,進展;持続,継続:
- Fortpflanzung[GDJW]1生殖,繁殖,増殖:
- Frage[GDJW]1 a)(↔Andwort)問い,質問;〘言〙疑問〔文〕:
- Frau[GDJW]2(↔ Mann)(Ehefrau)妻,
女房,細君,婦人:
- Freiheit[GDJW]1⦅ふつう単数で⦆自由,
無拘束;解除,解放,釈放;(義務・責任からの)免除:
- Frieden[GDJW]1 a)⦅単数で⦆(↔ Krieg)平和,
平和の状態,平時;講和:
- Frucht[GDJW]2 b)⦅ふつう複数で⦆〘法〙果実,
収益:
- Furcht[GDJW]1
恐れ,恐怖〔感〕;不安,心配(Furcht の場合には Angst より恐れや不安の対象がはっきりしている):
[GRIMM]5) etwas das befürchtet wird, ein gegenstand der furcht:
Zusammensetzungen, in denen furcht als letztes wort steht, sind nach den bereits erwähnten ehrfurcht und gottesfurcht: fürstenfurcht, geisterfurcht, gespensterfurcht, gewitterfurcht, höllenfurcht, knechtesfurcht, lebensfurcht, menschenfurcht, scheinfurcht, sclavenfurcht, seelenfurcht, todesfurcht, tyrannenfurcht (Schiller 613b), unfurcht, vorfurcht, wasserfurcht (= wasserscheu, in Matth. Hammer histor. rosengarten, Zwickau 1654, s. 428).
☞ Ruhm Furcht ≒ Ehrfurcht ?
[GDJW] Ehrfurcht⦅雅⦆畏敬,崇敬,賛仰:
[DUDEN] Ehrfurchthohe Achtung, achtungsvolle Scheu, Respekt vor der Würde, Erhabenheit einer Person, eines Wesens oder einer Sache
[Friedrich Nicolai, Allgemeine deutsche Bibliothek, Bd. 42, Berlin und Stettin 1780, S. 426.]Wenn er sich von Ruhmfurcht hier frey sprechen will: so hintergeht er sich selbst.
-
- Gang歩み[GDJW]1⦅単数で⦆
歩き方,足どり,歩調:
- Garantie[GDJW]1保証,
請け合い:
- Gebiet[GDJW]1
地域,地帯;〈国の〉領土,領域:
- Gebäude建築[GDJW]1(特に比較的大きな)建造物,
家屋,建物:
- Gebet[GDJW]祈り,
祈禱〔文〕:
- Gebot戒め[GDJW]1(宗教的・倫理的な)
律法,戒律,おきて:2 a)(法律上の)規則,指示[GRIMM]3) zu gebieten in der gewöhnlichen bedeutung, ursprünglich ein bestimmter befehl oder auftrag mit weisender, winkender oder drohender handbewegung (s. sp. 1756. 1754). begriff und gebrauch waren bis ins 16. jh. oder länger weit ausgedehnter als jetzt, wie bei gebieten.
a) vom gebietenden heiszt es ein gebot thun, gewiss von jeher, schweizerisch pot tuon weisth. 5, 126;
übrigens auch ein gebot gebieten (sp. 1758 fg.), und das gebot selbst als gebietend: das vierte ist noch ein ganz hübsches, vernünftiges gebietendes gebot. Göthe 17, 401 (wahlv. 2, 18), von den zehn geboten.
4) der begriff fordert aber überhaupt noch nähere betrachtung, zunächst der begriff an sich.
a) der sicherlich älteste begriff eines einzelnen gebotes, auf einen bestimmten fall bezüglich, erweitert sich von selbst
β) ein dauerndes, umfassendes gebot wird zum gesetz o. ä., z. b. von reichsgesetzen:
d) gebot gottes u. ä. (der natur, der kirche), im vorigen schon oft belegt, braucht doch noch besondere betrachtung, vergl. dazu gebieten 3, b.
β) gewöhnlich nimmt gottes gebot bezug auf die bibel oder das dogma, auch im sing., z. b.:
schon früh vielfach ohne gottes, als selbstverständlich:
ε) auch ein weltliches eilftes gebot wird angeführt, in verschiedenem sinne (gewiss auch von dem u. δ):
- Gebrauch[GDJW]1⦅単数で⦆使用,
利用:(☞gebrauchen)
- Geburt出自[GDJW]1(英:birth)b) 誕生,出生;⦅比⦆
発生,起源:2 ⦅単数で⦆血統,素性,出身;家柄:
- Gedanke思考枠組[GDJW]1 a)(英:thought)
考える〈思う〉こと,思考;考え〔の内容・対象〕;思想;(Einfall)思いつき,アイディア,着想;(Vorstellung)表象,想像;概念,観念:
- Gedankending思考枠組上の〈としての〉物
[GRIMM]
nur gedachtes ding, ding in gedanken (Campe): als ob er ... nur als gedankending existirte. Kant 5, 100 u. o., er braucht es gleich νοούμενον; s. auch gedankenwesen.
- Gedankenlosigkeit支離滅裂,思考枠組を欠いたさま(様態)[GDJW]1⦅単数で⦆gedankenlosなこと.2gedankenlos な言動.(☞gedankenlos)
[GWb]
a Mangel an geistiger Aufmerksamkeit u Einsicht
b Mangel an künstlerischer Gestaltungskraft u an Gehalt
- Gedrücktheit[GDJW]意気消沈,
落胆:
- Gefühl[GDJW]1感情,
気持ち,気分:☞Affection
- Gegenliebe[GDJW]愛にこたえること〈気持ち〉;
⦅比⦆(善意でしたことに対する)称賛,よい反響:[GRIMM]gegenliebe, f. mutuus amor
- Gegensatz[GDJW]1 a)
反対,逆,対照;,対立,矛盾,敵対:[GRIMM]subst. zu entgegen setzen (vgl. u. gegen III, 1, b), seit dem 16. jh.: gegensatz, oppositio, oppositus Maaler 162d, nach Frisius 922a (wo auch oppositus gegen gesetzt); noch bei Dasyp. 189b nur oppositio, gegensetzung, wie noch jetzt widersetzung, nicht widersatz (aber mhd.), vergl. entgegensetzung, gegensetzung.
2) gewöhnlich vielmehr von worten und gedanken u. ähnl.
e) philosophisch und sonst in gedankenmäsziger erörterung:
3) der begriff hat auch inhaltlich eine merkwürdige verschiebung erfahren, wie noch deutlicher ist bei widerspruch und widersprechen (auch entsprechen), d. h. von einem entgegengesetzten satze oder ausspruch auf ein gegensätzliches verhältnis (b), wo endlich auch von worten und sprechen gar nicht mehr die rede ist.
- Gegenstandlichkeit対象全体[GDJW]
客観性,即物性,具体性:[GRIMM]gegenständlichkeit, f. objectivität
ein ganzes von gegenständen;
- Gegenstoß[GDJW]突き返し;
〘ボクシング〙カウンター;〘軍〙反撃,反攻:
- Gegenteil[GDJW]1
逆,反対;逆(反対)のもの:
- Gegner[GDJW]反対
〈敵対〉者;(試合の)対戦相手,敵方;敵〔軍〕:
- Gehorsam[GDJW]II 1
服従,従順:
- Gemeindeコミュニティ[GDJW]1
地方自治体(市町村);⦅集合的に⦆市町村民;市役所,町村役場:2〘宗〙教区,教会;⦅集合的に⦆教区民;(礼拝の)会衆;(宗派の)信徒:3(Gemeinschaft)同好会,協会;⦅集合的に⦆同好の士.
- Gemeinsamkeit[GDJW]1 共通の点,共通の性質:2 ⦅単数で⦆共同,共有;連帯.[GRIMM]
subst. zu gemeinsam (vergl. gemeinsame), communio, communitas voc.
1) gemeinschaft, gemeinsames wesen, leben u. ä.:
2) die gemeinschaft oder gemeinde in ihren mitgliedern:
3) vertraulichkeit u. ä. (s. gemeinsam 2):
- Gemeinschaft共同体[GDJW]1(利益ではなく,連帯感に基づく)
家族体,共同社会(→Gesellschafft 1 a):
- Gemeinwesen共和国[GRIMM]
res publica
- Gemüt心 [GDJW]1⦅単数で⦆
心情,情緒,気質:
- Genese[GDJW]
発生,由来;生成発展.[gr. génesis „Entstehen“ –lat.; ...]
- Genesis[GDJW]2= Genese [gr.]
- Genuß[KS]①享受(有),
利(受)用.[GDJW]2喜び〈満足〉〔をもたらすもの〕,享楽:[GRIMM]3) im jetzigen begriff fällt das hauptgewicht auf die lust, die den genusz begleitet und freilich von jeher darin eingeschlossen ist, aber nicht als hauptmerkmal (s. genieszen 6); es ist bemerkenswert, dasz kein wörterbuch auszer Ludwig (s. 2, a) die lust besonders bezeichnet, bis auf Adelung (s. unter d), noch bei Frisch 2, 19a ist es nur commodum, quaestus, utilitas, während bei genieszen (6, a) schon im 17. jahrh. ausdrücklich mit von lust die rede ist. der begriff der lust erscheint dabei in einer bewegung aufwärts, vom sinnlichsten ausgehend dem hohen und reinen zu, ja mit umschlagen in sein gegentheil, ein wichtiges stück aus der geistes- und lebensentwickelung des vorigen jahrhunderts.
- Gerechtigkeit[GDJW]1⦅単数で⦆(gerecht なこと.例えば:)正義,
公正,公平(シンボルは:→図 Symbol):正当〔性〕;〘聖〙義:
- Gerichtsbarkeit[GDJW]1⦅単数で⦆裁判〔管轄〕権:
- Gerüst[GDJW]2 c)〘工・美〙
芯組み,骨格:
- Gesamt[GDJW]II= Gesammtheit:
- Gesamtheit全部[GDJW]⦅ふつう単数で⦆
全体;総量,総数;全員:(☞gesamt)
- Geschäft業務,営み[GDJW]1 a)
用事,仕事:b)取引,商売,ビジネス:(☞Beschäftigung)
- Geschicklichkeit[GDJW]
巧みさ,器用:[Schinzinger]巧妙,手際,熟練;器用;才,技能.
- Gesichtspunkt[GDJW]1
視点,観点,見地,見解:
- Gesinnung[GDJW](個人のもつ根本的な)
物の考え方,心的態度,心根,心情,志操,主義:
- Gestalt[GDJW]1⦅ふつう単数で⦆a)(特定の)
形,形状,形態,姿;(人間の)外形の姿,体格:(☞gestalten)
- Gewalt[GDJW]1(Macht)
力,権能,権力,支配力,制御力:unter js. ~3 sein 〈stehen〉 …の支配下にある‖[GDJW]2⦅単数で⦆無法〔な圧力〕;(肉体的)暴力:
[GDJW] bringen2 c)et.4 unter sich4 〈unter seine Gewalt〉~ …を支配する〈支配下に置く〉|
- Gewalttätigkeit強大な権力行使[GDJW]gewaltigなこと。(☞gewaltig)
- Gewinn[GDJW]1利益,
収益,利得,もうけ;⦅比⦆益,得:
- Gewissen良識[GDJW]1(個人の)
良心,善悪の判断力,道徳意識:
[GRIMM](fem. und) neutr., verstärkte form des substantivierten infinitivs wissen, die sich in der nhd. schriftsprache an stelle eines älteren, vom participialen adjectiv (s. gewissen III) abgeleiteten femininums (vgl. gawiʒanî Graff 1, 1097; mhd. wb. 3, 791a, s. unten 1) durchgesetzt hat. in beiden formen ist die umfassende grundbedeutung des wissens, der kenntnis von einer sache zur entfaltung gekommen; am neutrum ist sie freilich nicht so reich belegt und nicht so mannigfaltig entwickelt, wie am fem., das namentlich in der rechtssprache eigenartige wendungen abzweigte. für dieses fem. war auch der übergang zu dem religiösen — allgemeiner ethischen — begriffe, von dem unser schriftsprachlicher gebrauch getragen ist, eine möglichkeit der inneren entwicklung, die freilich durch den zwang, das vorbild der lateinischen conscientia nachzuahmen, überholt wurde. gleich diesem und dessen spätgriechischem urbilde, der συνείδησις, der unser fem. in der inneren anlage noch näher steht, hatte auch das deutsche wort einen längeren weg der bedeutungsverengerung durchzumachen, um zum heutigen ethischen begriff zu kommen.
während das lateinische präfix (con) und noch mehr das griechische (συν) einem sociativen moment (der theilnehmerschaft an der verbalhandlung) ausdruck giebt, das erst im späteren verlauf der bedeutungsentwicklung verblaszt, hat das deutsche präfix — wenn ihm auch in späteren deutungen das gleiche angedichtet wird — von hause aus eine andere function: die perfective, die am klarsten beim fem. zu tage tritt.
eben dem einflusz Luthers ist es aber zuzuschreiben, dasz das fem. nunmehr ganz vor dem neutrum zurückweicht, dessen ältere verwendungen keine so lückenlose verbindungslinie zu diesem ziele zeigen; selbst Melanchthon, von dem einzelne drucke noch das fem. zeigen, geht zum neutrum über:
diese anklänge an die grundbedeutung treten am ehesten da zurück, wo die regungen des gewissens über das menschliche subject hinaus unmittelbar auf göttliche einwirkung zurückgeführt werden. dies ist die eine richtung, in der sich der religiöse begriff zunächst bethätigt:
von dieser auffassung wird auch das volksempfinden im allgemeinen beherrscht; für die beurtheilung einzelner fälle tritt eine andere richtung, eine bedeutungsverengerung in kraft, die Schopenhauer kennzeichnet, vgl.: religiöse leute, jedes glaubens, verstehen unter gewissen sehr oft nichts anderes, als die dogmen und vorschriften ihrer religion und die in beziehung auf diese vorgenommene selbstprüfung. (grundlage d. moral 13) 3, 573
dieser verengerung des religiösen begriffes tritt bei den philosophen eine erweiterung entgegen, indem die gegebenen thatsachen nunmehr unter dem gesichtspunkt der ethik gewertet und erklärt werden. je weiter sie in die neuere zeit hereinreichen, um so mehr dehnt sich auch der umfang des begriffes in den feststellungen aus: das urtheil von unseren handlungen, ob sie gut oder böse sind, wird das gewissen genennet. Chr. Wolff ged. v. d. menschen thun u. lassen § 73 (1720) 45; man könnte das gewissen auch so definiren: es ist die sich selbst richtende moralische urtheilskraft. Kant (religion innerh. der grenzen d. bloszen vernunft 4. stück § 4) 6, 371
andererseits wird es Lavater, der unserem engern begriff des gewissens einen umfassenderen begriff entgegenstellen will, nicht bewuszt, dasz hierfür schon die grundbedeutung unseres substantivs zuständig wäre; er giebt diesem weiteren begriff einen namen, der um diese zeit von England aus mit gewissen in concurrenz trat: moralisches gefühl (s. sp. 2177): es ist ein unterschied zwischen gewissen und moralischem gefühle; das gewissen urtheilt nur über geschehenes, nur über deine eigne handlungen und gesinnungen. das moralische gefühl über gleiche, auch über fremde handlungen. kleinere pros. schriften 3, 237f.; vgl. dagegen: gibts ein gewissen, ein moralisches gefühl, das mir, abgetrennt von allem erkenntnisz, richtigen weg zeige? Herder (vom erkennen u. empf.) 8, 199; Fichte, der gewissen und bewusztsein identifiziert, läszt sich auch die etymologische verwandtschaft beider bildungen nicht mehr entgehen: die formale bedingung der moralität unserer handlungen, oder ihre vorzugsweise sogenannte moralität besteht darin, dasz man sich schlechtin um des gewissens willen zu dem, was dasselbe fodert, entschliesze. das gewissen aber ist das unmittelbare bewusztsein unserer bestimmten pflicht. sittenlehre (1798) 225; dazu vgl.: ich bin im gewissen, durch mein wissen wie es sein soll, verbunden, meine freiheit zu beschränken. naturrecht (1796) einl. s. 14. und Hegel stellt seine begriffsbestimmung ganz auf die etymologische grundlage: allein dieser unterschied des allgemeinen bewusztseins und des einzelnen selbsts ist es eben, der sich aufgehoben, und dessen aufheben das gewissen ist. das unmittelbare wissen des seiner gewissen selbsts ist gesetz und pflicht; seine absicht ist dadurch, dasz sie seine absicht ist, das rechte; es wird nur erfordert, dasz es diesz wisse und dasz es die überzeugung davon, sein wissen und wollen sei das rechte, sage. das aussprechen dieser versicherung hebt an sich selbst die form seiner besonderheit auf; es anerkennt darin die nothwendige allgemeinheit des selbsts; indem es sich gewissen nennt, nennt es sich reines sich selbst wissen und reines abstraktes wollen. ... wer also sagt, er handle so aus gewissen, der spricht wahr, denn sein gewissen ist das wissende und wollende selbst. (phänom.) 2, 493; vgl. auch (grundlinien der phil. d. rechts) 8, 179.
- 3) an den alten verbindungen hält auch das neutrum fest, nur die mit objectivem genetiv stirbt früh ab, vgl. sp. 6245.
- c) die attributiven verbindungen, die uns der neuere stil schon bei den eben besprochenen gruppen nahegebracht hatte, zeigen nun auch auf ihrem eigentlichen gebiete in allen richtungen neben der bewahrung alten bestandes die spuren neuerer entwicklung,
- β) unter dem einflusz dogmatischer und philosophischer erörterungen wird der auf die functionen des subst. zielende gegensatz zwischen sicherem und unsicherem, richtigem und irrendem gewissen angebaut:
- γ) mit den letzten attributen berühren sich am nächsten die attribute, die den zustand des substantivs kennzeichnen:
freude uber alle freude, ist ein gut sicher gewissen, und leid uber alles leid ist das hertzleid, das ist, ein böse gewissen, denn ein böse gewissen, ist die helle selbs, und ein gut gewissen, ist das paradis und himelreich. Luther (verantwort. der auffrur) 6, 10b Jena; während das fem. den gegensatz von rein und unrein (beschwert und leicht) stärker pflegte, liegt beim neutrum der schwerpunkt auf dem gegensatz von gut und böse, der in ungewöhnlicher mannigfaltigkeit ausgestaltet erscheint, vgl. auch sp. 6246. 6250/1. der neuere contrastbegriff zu gut, das im heutigen zwanglosen stil so beliebte attribut schlecht, ist litterarisch verhältnismäszig wenig beobachtet:
- Gewohnheit[GDJW]1習慣;習癖,癖:
- Gipfel[GDJW]2⦅比⦆(Höhepunkt)頂点,絶頂,極致,クライマックス:
- Gleichgewicht[GDJW]⦅ふつう単数で⦆
釣り合い,平衡,均衡,バランス,安定;⦅比⦆(心の)平静,落ち着き:
- Gleichheit同等態[GDJW](gleich なこと.例えば:)
同一;同等,対等;平等:均一:
- Glied[GDJW]2 a)
構成要素(分子),成分,成員;(鎖の)環:ex)一員.b〘論・数〙項,名辞.(☞Mittelglied)
- Grenze[GDJW]1(領土・地域などの)境界〔線〕;⦅複数で⦆(境界内の)領土,領域;2
限度,限界;枠,範囲:
- Grund[GDJW]2⦅単数で⦆(英:bottom, basis)(Boden)底(水底・谷底・容器の底など);(Grundlage)
(建物の)土台;根底、基礎;内奥、(心の)奥底:3(英:reason)根拠、理由、動機、原因、都合:
[GRIMM]
II. 'erdboden', neben 'meeresboden' u. ä. der andere grosze bedeutungsstrang des subst., für den ursprünglich das feminine geschlecht anzusetzen ist (s. o. form 1); die bedeutung ist, verschieden variiert, ags., anord. und ahd.
B. präpositionale wendungen.
2) zu grunde als prädicative bestimmung neben intrans. verben; zu sondern von zu grunde sinken, gehen u. ä. (s. o. I A 4 c β) und weit weniger entwickelt als jenes:
3) in den grund wird ebenso und meist neben denselben verben gebraucht wie zu grunde; die formel gilt hier wie dort von haus aus der richtungsbezeichnung; nur so versteht sich zumal die wendung in den gr. legen 'zerstören':
doch tritt neben die locale frühzeitig eine intensitätsvorstellung; deshalb auch verstärkt bis in den gr. oder in gr. hinein 'bis in den boden hinein, gründlich, gänzlich. darum bevorzugt Frisch 379a, den ausgangspunkt der formel verkennend, im gr.: eine stadt im gr. zerstören a fundamentis proruere urbem, desgleichen das land im gr. verwüsten flamma ferroque depopulari agros; doch ist im gr. eine jüngere seltene umbiegung.
a) transitiv; noch entschiedener als bei zu gr. tritt in der älteren sprache die zerstörung von städten und gebäuden hervor:
(☞zugrunde gehen)
- Grundlage基礎[GDJW]1
基盤,根柢;根拠:[GRIMM]die (unterste) schicht auf der ein ding ruht, unterlage, basis, fundament;
4) bei formelhafter verbindung mit verben ist die eigentliche bedeutung theils deutlich; z. b. eine gr. legen; auf einer gr. bauen, errichten; eine gr. untergraben, erschüttern u. s. w.:
theils ist die bildvorstellung verblaszt: die gr. bilden, auf einer gr. beruhen, zur gr. dienen u. s. w.: diesz thema ..., das die gr. für die ausführung bildet, ist das abstrakte Hegel w. I 1, 125;
- Grundsatz[GDJW](Prinzip)
原理,原則18/19;主義:
- Grundsäule = Grundpfeiler[GDJW]〘建〙
支柱,大黒柱:
- Gut[GRIMM]
IV. gut bezeichnet die sinnesrichtung einer person hinsichtlich ihres verhaltens zu anderen personen und die akte und ergebnisse solchen subjektiven gesinnungsausdruckes nach verschiedenen seiten hin; als grundlage der einzelbedeutungen läszt sich die bedeutung 'geneigt, wohlmeinend, freundlich' ansehen, die das als ausgangsbedeutung erschlieszbare verhältnis des verbundenseins, passens, taugens (vgl. sp. 1228) auf das gebiet des psychischen überträgt;
B. alt ist auch die beziehung auf formen des subjektiven gesinnungsausdrucks, also abstracta wie gesinnung, meinung, wille u. ä.; vgl. neben den alten bezeugungen für guter wille (s. u. 2) altnord. góðr hugr 'wohlwollen':
VIII. substantivierungen des adj. gut mit adjektivischer flexion begegnen seit ahd. zeit.
B. substantivierung des adj. neutr. mit artikel und schwacher flexion das gute ist ahd. und mhd. selten, weil das substantivisch flektierte neutr. ohne artikel (s. u. 1DWb gut, n., A) den gebrauch beherrscht, im nhd. aber besonders in jüngerer sprache ausgebreitet.
4) zu gut IV B in festen präpositionalen verbindungen, die aber auch artikellos mit starker flexion auftreten (s. u. 1DWb C) und den älteren gebrauch des substantivisch flektierten subst. neutr. (s. u. IX B) teilweise ablösen.
a) im guten 'in gewogenheit, freundschaft, freundlichkeit'; die doppelte möglichkeit im guten oder in gutem führt auch zu der mischform in guten:
b) mit guten in gleichem sinne bleibt seltener:
c) in verwandten wendungen: Xenophon hält mehr davon, dasz man ihnen (den pferden) die lippen mit den fingern niederdrucke, das thut ihnen nicht wehe und behält sie beym guten (in williger verfassung) J. Walther pferde- u. viehzucht (1658) 21; artikellos: welche beyde stücke von alters her für sehr nöthig geachtet worden, das neugierige volck bey guten zu erhalten J. J. Mascou ges. d. Teutschen 2 (1737) 65;
- Gütigkeit[GDJW]有効,効力,通用,妥当性:
-
- Halbheit端役[GDJW]1⦅単数で⦆半分であること;中途半端,不充分;不決断:
- Hand[GDJW]1 ②〖前置詞と〗unter der ~ ひそかに,こっそり:
- Handlung[GDJW]1(Tat)行為,
行動,所業;〘法・社〙行為;〘心〙動作;(宗教的な)儀式:
- Härte[GDJW]⦅ふつう単数で⦆2
厳しさ,過酷さ;かたくなさ,非情さ;不屈さ:
- Haufen[GDJW]3 a)(Schar)(人間や動物の)群れ,
大勢,多数:b)⦅話⦆(特定の)集団,一味,仲間;⦅軽蔑的に⦆大衆,愚民:
- Hauptpunkt焦点[GDJW]1
要点,中心(主眼)点:2〘光〙主点:[GRIMM]2) hauptpunct, punctum visus, in der perspective der punkt auf einer tafel, wo die linie hinfällt, die aus dem auge perpendicular darauf gezogen wird.
- Hauptsache主要事項,核心事[GDJW]1
主要〈最も重要〉なこと:(ex.) zur Hauptsache kommen 核心に触れる‖ 2〘法〙a)主たる物、主物
- Haustier[GDJW]家畜(家禽をも含む),愛玩動物,ペット.
- Hemmung[GDJW]2
ためらい,気おくれ,逡巡,心理的圧迫;〘心〙抑制:
- Herz心胸[GDJW]1 a)(英:heart)
〘解〙心臓(心臓のありかとしての)胸:2心,心情,気持;元気,勇気:jm. Herzen liegen…にとって 気がかりな〈切実な問題〉である :
- Herrschaft[GDJW]1⦅単数で⦆a)支配〔権〕,
統治〔権〕,権力;統制,管理::2領主;主人(一家);⦅ふつう複数で⦆(身分の高い)人々,紳士淑女たち:4〘史〙領地,荘園.[ahd.; ◇hehr]
- Herrenschaft領主権
[GRIMM]
f.:
der general, [/]
so hört ich, hat die ganze macht der Neger [/]
zum sturm auf cap François versammelt; morgen [/]
soll der entscheidung blutgeweihter tag [/]
der weiszen herrenschaft ein ende machen. [/]
Körner 2, 35.
- Hinsicht[GDJW]in ∼ auf et.4
…の点に関して,…のことを考えて〈考えると〉;…であるがために:
- Hintergrund[GDJW]1⦅ふつう単数で⦆(↔Vorgrund)(絵・景色などの)
背景,遠景,バック;⦅比⦆目立たない〈日の当たらない〉場所,背後:
- Hin und Her[GDJW]⦅話⦆あちこちうろうろ〈行ったり来たり〉すること;⦅比⦆あれこれと考えること,逡巡,(議論が)なかなか決しないこと:(☞ hin)
- Hochmut[GDJW]1高慢,
うぬぼれ,尊大,不遜:
- Hohe[GDJW]2(抽象的な)高さ,
大きさ,程度:
- Hohn[GDJW]1
あざけり,嘲笑,侮蔑:
- Hunger[GDJW]1(英:hunger)空腹,飢え,飢餓:
- Hypothese[GDJW]仮説,仮定,仮言:
-
- icht
[GRIMM]
icht, subst. pron., aliquid.
1) ahd. êo-wiht, êoweht, eowit, iowiht, ieweht, iuuiht (Graff 1, 732), alts. êo-wiht, mit der noch ganz durchsichtigen bedeutung irgend ein ding (über das alte êo vgl. unten unter je), mhd. in den verschiedensten formen gekürzt. schon Notker schreibt ieht; im 13. 14. jh. ist iht die gewöhnliche form, woneben icht, ieht, iet, itt (ytt Altswert 148, 8), id, iewet, iwit, iut, üt, üd, ut in gebrauch waren (vgl. Weinhold alem. gramm. § 322, bair. gramm. § 255). mnl. und nnl. entspricht iet; ags. âviht, âvuht, âuht, âht, engl. aught, ought (I never gave you aught. Shakespeare Hamlet 3, 1); altfries. âwet, âet, neufries. aet.
icht ist noch im 15. und 16. jahrh. ein häufig gebrauchtes wort, das erst im 17. abstirbt. mundartlich, schwäbisch gilt bis jetzt icht in der verbindung ichtes icht (Schm. 1, 30 Fromm.).
2) icht wird zunächst wie ein substantiv flectiert und in verschiedenen casus gebraucht. über den genitiv ichtes, ichts s. unter ichts; der dativ, namentlich in den formeln mit ichte (mhd. mit ihtiu in instrumentaler flexion krone 11670), in ichte:
3) gewöhnlich ist aber icht nur als nominativ und accusativ, in der bedeutung etwas, verwendet. ein näher bestimmendes substantiv tritt im theilungsgenitiv hinzu:
4) in abhängigen und conditionalen sätzen in negativer bedeutung, im sinne von nichts:
5) icht wird adverbialer accusativ, wie schon mhd., mit der bedeutung etwa, irgend:
6) icht in abhängigen und conditionalsätzen mit negativer bedeutung, wie nicht:
(☞ nichts)
- ichts
[GRIMM]
ichtes, ichts, der genitiv des oben behandelten icht, der mhd. in der formel ihtes iht zu dem letzteren worte nur verstärkend zutrat. durch zusammenziehung dieser formel entstand ichtesicht mit seinen verstümmelungen (s. an alphabetischer stelle), durch verlust des regierenden icht erhielt, seit dem 14. jahrh., der regierte genitiv ichtes für sich allein den sinn irgend ein ding, etwas. ichtes lebt, zuletzt nur in einer formel (s. no. 4) bis ins 17. jahrh., zum schaden der sprache entgeht es uns jetzt, während die ganz gleich entwickelte negation nichts besteht.
1) irgend ein ding, etwas; gewöhnlich absolut gebraucht:
2) seltener sind appositionen zu ichtes:
3) ichts in verbindung mit negativen pronomen, wie niemand, keiner, nie, verliert seine bestimmte positive bedeutung, da nach dem älteren sprachgebrauche gleichgiltig an seiner stelle auch nichts stehen kann:
4) in der häufigen zusammenstellung von ichts mit seiner negation nichts hat sich das wort am längsten erhalten (vgl. dazu auch die formel aut oder naut theil 1, sp. 1044):
5) ichtes ist adverbial geworden (wie icht no. 5), in der bedeutung irgendwie, etwa, vielleicht:
(☞ nichts)
- Identität同一態[GDJW]1 同一性;(…と)同一である〈一致している〉こと;本人〈そのもの〉であること:
- Immobilie[GDJW]⦅ふつう複数で⦆(↔Mobilie)不動産,
固定資産:
- Imputation責任転嫁[GDJW]2〘キリスト教〙
罪の転嫁:
- Inbegriff[GDJW]1(Gesamtheit)
総体,総括〔概念〕:
- Individuum[GDJW]1 個体,個人:
- Individualität個体性[GDJW]1⦅単数で⦆
個性.2(個性に持ち主としての)個人.[fr.]
- Insichseynこころみ 本来存在:(☞ in sich)
- Insofern[GRIMM]
adv. und conj., in dér hinsicht, in dér beziehung, vgl. in sp. 2103 oben und inwiefern.
3) substantive stellung: aus diesem denn, aus dieser ursache, macht Corneille ein insofern, eine blosze bedingung. Lessing 7, 367.
- Institution制度[GDJW]1 b) 社会的な制度〈慣習〉:
- Intelligenz知性[GDJW]1 ⦅単数で⦆
知力,知能;聡明さ:
- Intention[GDJW]1
意向,意図,企図,もくろみ;志向.
- Interesse利害関心[GDJW]1 a)⦅単数で⦆
興味,関心:(ex.) Ich habe kein ~ 〔daran〕, ihn kennenzulernen. 私は彼と知り合いになりたいとは思わない。|2利益,利害関係:(☞Vorteil)
- irgendein[GDJW]⦅不定代名詞⦆1⦅形容詞的に: ein の部分は不定冠詞と同じ変化⦆だれか〈なにか〉ある;任意の:→ein1 I 1 b
- Irrtum誤謬[GDJW]
誤り,間違い;(特に:)思い〈考え〉違い,謬見;〘法〙錯誤 [KS](ant. Wahrheit)思い(見当)違い,誤謬(解);錯誤(覚);
- Isorierung[GDJW](isolieren すること.特に:)
〘電〙絶縁;〘心〙孤立,隔離.
-
- Kanon[GDJW]I 1〘楽〙カノン.2(Norm)規準,
規範,準則:
- Kampf[GDJW]戦い,戦闘,闘争,
格闘;〖スポーツ〗試合,競技:
- Kaprice[GDJW]気まぐれ,
移り気,むら気:
- Kenntnis[GDJW]1⦅ふつう複数で⦆(個々の事柄に関する)〔専門的〕知識:2⦅単数で⦆知っていること,
承知[GRIMM]kenntnis, f. und früher n., scientia, notitia, cognitio.
4) der begriff hat übrigens zwei seiten, wie kennen (s. sp. 541). es wird einmal im strengen sinne gebraucht für genaue kenntnis, einsicht ins wesen einer sache, z. b.: obgleich ich von der intelligiblen welt eine idee habe, so habe ich doch von ihr nicht die mindeste kenntnis. Kant 4, 91, eine auf erforschung und einsicht gegründete erkenntnis. auch auszer der philos. sprache wird so, wie bei kennen (sp. 542) unter kenntnis oft ein kennen aus eigner erfahrung oder anschauung verstanden. [/]
Anderseits kann kenntnis aber auch ein mehr äuszerliches kennen sein, wo bei aller anschauung und erfahrung dennoch die einsicht ins wesen (erkenntnis) mangelt, z. b.: wenn auch (in der Düsseldorfer bildergallerie) nicht eben meine einsicht vermehrt wurde, meine kenntniss ward doch bereichert. Göthe 26, 294; jene kenntniss ist keine erkenntniss, sondern ein bloszes auswendiglernen von willkürlichen wortzeichen. Fichte 7, 407. es kann einer in einer sprache viele kenntnisse haben (s. 2) und von einer kenntnis derselben doch recht fern sein. Auch in dem kenntnis nehmen 3, d wiederholt sich diese doppelheit, nicht nur ein genaues 'einsicht nehmen' nennt man so, was es urspr. war, man braucht es nun auch für ein ungefähres sich drum kümmern.
- Kesselflicker銅修繕工[GRIMM]
das kesselflicken betreibt.
die kesselflickerei gehört zu den verachteten, ehrlosen gewerben, wol weil sie früher vorzugsweise von den zigeunern betrieben ward oder ähnlichen vagierenden leuten, wie noch jetzt arme Slowaken, Hannaken in dieser rolle auftreten, z. b. in Sachsen, Schlesien, Österreich. sie sind die pfuscharbeiter unter den kaltschmieden, und wie diese selbst einst rechtlos waren und den zigeunern gleich geachtet, auszer in der Churpfalz wo sie besonderes schutzes genossen, so betrachteten die kaltschmiede jene wieder als unter sich stehend, wie die stelle aus dem Simpl. unter kaltschmidtzunft zeigt. in handwerksstatuten fand sich die bestimmung, dasz ein als lehrling aufzunehmender u. a. nicht von kesselflickern abstammen dürfe;
- Kirchengemeinde[GDJW]1教区,
牧師管区:
- Klarheit明晰[GDJW]⦅ふつう単数で⦆klar なこと:(☞klar)
- Klasse[GDJW]3 a)(略 Kl.)等級
- Knotenlinie結節線[GRIMM]
f. astronomisch, die gerade linie von einem knoten zum andern
- Kollision[GDJW]2(意見の)衝突,
対立,矛盾:
- Komplikation[GDJW]1紛糾,
もめごと:
- Kokarde[GDJW]〘軍〙1帽章(→図Mütze (
 ).[afr. coquard „eitel“ — fr. (nonnet à la) cocarde „(Mütze mit) Bandschleife"; ⋄kokett]
[WikiM-C]
).[afr. coquard „eitel“ — fr. (nonnet à la) cocarde „(Mütze mit) Bandschleife"; ⋄kokett]
[WikiM-C]

'Members of the Commune. (1793-1794.)'
The attire and clothing of individuals involved in the radical Paris Commune (French: Commune de Paris), the government of Paris from 1789 until 1795 during the French revolution; French revolutionary sans-culottes wearing iconic Phrygian caps (bonnets rouges) and tricolor cockades. The sans-culotte (left) is wearing full length trousers, the others wearing culottes (right, knee length breeches).
Book plate from Zur Geschichte der Kostüme ("On the History of Costume"), a German publication from Munich, Germany, originally released as a series of prints (Münchener Bilderbogen) starting in 1861 and later compiled into a book around 1900. The contributing illustrators for the costume plates included Louis Braun, W. Diez, Ernst Fröhlich, j. Gehrts, C. Häberlin, M. Heil, Andr. Müller, F. Rothbarth, and others.
(☞Cocarde)
- Konkurrenz[GDJW]1 a)⦅ふつう単数で⦆
競争,競合:
- Konsequenz[GDJW]1
(ある行為の)結果,(論理的な)帰結,結論:
- Körper[GDJW]1 a)(↔Geist)
からだ,身体:(☞körperlich)
- Kraft[GDJW]2 a)(自然界の)力、
働き;エネルギー:
[GRIMM]
4) kraft der naturdinge, naturkräfte.
a) allen dingen, nicht nur den lebendigen, legte man eine lebendige kraft bei, als äuszerung ihres wesens.
δ) aber die gesamte natur im ganzen und einzelnen hat solche kräfte in sich, als äuszerungen ihres innersten wesens: die kraft der element. weish. Sal. 7, 17, ἐνέργεια; 'kraft und eigenschaft' der elemente Göthe 12, 68, zugleich zu 11, d; wenn man siehet, dasz das licht leuchtet, so eignet man ihm eine leuchtende kraft zu (jetzt leuchtkraft). nimmet man wahr, dasz seine flamme erwärmet, so sagt man, es habe eine erwärmende kraft u. s. w. Chr. Wolff vernünftige ged. von gott § 746; mir (Werther) untergräbt das herz die verzehrende kraft, die in dem all der natur verborgen liegt. Göthe 16, 76;
d. i. die schwerkraft, selbst die nur körperlichen körper sind da von dem naturforscher als lebendige einzelwesen behandelt, entsprechend der uralten überlieferung. 'kraft und stoff'.
(☞Macht)
- Krieg[GDJW](↔Frieden)戦争,
戦役;戦時;⦅比⦆不和,敵対関係:
- Kreis圏[GDJW]1 a)円,
円形;輪,環;円周:2a)範囲,領域,圏:3(人々の)集団,グループ,サークル,仲間,一派:
- Kult祭儀[GDJW]1
祭式,礼拝:
- Kultus祭儀(☞Kult)[DUDEN]
1. an feste Formen, Riten, Orte, Zeiten gebundene religiöse Verehrung einer Gottheit durch eine Gemeinschaft
-
- Lage[GDJW]3⦅ふつう単数で⦆
立場,〈置かれた〉状況,状態,事態,情勢:
- Laie[GDJW]2(↔Geistliche)平信徒,
俗人.(☞lay)
- Land[GDJW]1⦅単数で⦆(英:land)(海・湖・河川・空などに対して)陸〔地〕,おか,大地:
- Langeweile[GDJW]⦅2・3格は冠詞を伴うとき Langenweile, 無冠詞のとき Langerweile となることもある⦆退屈:
- Last[GDJW]2⦅複数で⦆(経済的)負担(費用・負債・税金など):
- Lasttier[GDJW]運搬用役畜:
- Lauf[GDJW]1⦅単数で⦆走ること,走行;(機械の)運動,作動,回転;(Verlauf)(事態の)進行,進展,経過:et.3 seinen 〈freien〉 ∼ lassen …を成りゆきにまかせる|
- Laune気まぐれ[GDJW]2⦅複数で⦆気まぐれ,
移り気,むら気:[DUDEN]b) wechselnde Gemütsverfassung, Stimmung[en]
Grammatik meist im Plural
[GRIMM]laune, f. menschliche stimmung.
1) wie das wort, lehnwort aus dem lat. luna, im deutschen des mittelalters von seiner eigentlichen bedeutung des mondes, dann des mondenlaufes und mondwechsels zu der ihm jetzt und seit lange eigenthümlichen bedeutung gekommen ist, weist Wackernagel in Haupts zeitschr. 6, 143 ff. (= kleinere schriften 1, 251 ff.) nach: jener begriff des wechselnden mondes gieng über auf das Bd. 12, Sp. 345 wechselnde glück, das nach einer dem alterthume entsprossenen vorstellung als rad oder scheibe erschien, und endlich auf die wechselnde gemütsstimmung des menschen; zunächst ward wol an die des höhern gegen den niedern gedacht, die den glücksumständen des letztern unerwünschte veränderung brachte:
4) laune aber auch allgemeiner die augenblickliche gemütsstimmung jeder art, wie denn Göthe das wort im wechsel mit augenblicklicher stimmung braucht:
- Lebendigkeit生命態[GDJW]lebendigなこと:
- Leder[GDJW]1(動物の)なめし革,革,皮革;⦅話⦆(Haut)(人間の)皮膚,肌:
- Legitimität正統性[GDJW]1
合法〔性〕,正当〔性〕:2嫡出;(君主の)正統:
- Lehre論[GDJW]1
教え,教義,(学)説,学,体系:[GRIMM]2 ... c) lehre von etwas; die lehre von der erbsünde; die lehre von der dreieinigkeit; die lehre von den pflichten; die lehre von der elektricität, vom schalle, vom licht u. s. w.;
- Leib[GDJW]1(↔Seele)(Körper)肉体,
身体:
- Leibeigene隷属民[GDJW]⦅形容詞変化⦆(↔Freie)〘史〙農奴、隷農、世襲隷〔属〕民:
- Leiden受苦[GDJW]2⦅ふつう複数で⦆
苦しみ,悩み,苦悩:3苦しむこと,悩むこと;受難:
- Leidenschaft[GDJW]1(抑えがたい)
激情,情熱,熱情;熱中〔の対象〕:
- Leistung奉仕[DUDEN]
3. Dienstleistung
- Lotterie宝くじ[GDJW]
富くじ:
- Luft[GDJW]1⦅ふつう単数で⦆(英:air)空気,大気;⦅比⦆雰囲気,気配:
-
- Macht[GDJW]1⦅単数で⦆
力;1 b)(Kraft)威力,影響力:
[GRIMM]
1) goth. mahts; ahd. mhd. alts. altnfr. maht; niederl. magt; ags. meaht, meht, miht, altengl. maht und miht, neuengl. might; fries. mecht; altnord. mâttr, schwed. makt, dän. magt; das allen germanischen sprachen angehörige subst. zu dem verbum goth. magan, unserm mögen, dessen eigentliche bedeutung kraft, zumal zeugungskraft haben ist, s. dort und unter vermögen, sowie nachher unter nr. 13. der umgelautete dat. gen. sg., mhd. mehte, ist kaum über die mhd. zeit hinaus geblieben:
4) gewöhnlicher erscheint der begriff von macht deutlich gesteigert zu dem der überlegenen kraft, die sich in der befugnis zu etwas äuszert: macht ist ein vermögen, welches groszen hindernissen überlegen ist. Kant 7, 100. es ist synonym zu gewalt und mit diesem formelhaft verbunden:
5) auch nichtpersönlichem wird macht beigelegt (vgl. dazu auch beispiele aus oben 4, g):
in der neueren sprache gern in bezug auf seelisches oder geistiges: die macht der liebe, die macht der vorurtheile, die macht der gewohnheit, die öffentliche meinung ist eine macht; es gibt für die mathematische gröszenschätzung kein grösztes, denn die macht der zahlen geht ins unendliche. Kant 7, 101;
11) auf ihr steht die heutige bedeutung von macht für staat, sofern er sein ansehen kriegerisch geltend machen kann: der staat .. der in verhältnis auf andere völker eine macht (potentia) schlechthin heiszt. Kant 5, 143;
(☞Kraft)
- Magazin収容所[GDJW]1(Lager)倉庫,
貯蔵庫;(図書館の)書庫,(美術館・博物館の)収蔵庫;デパート;大型ストア:
- Majestät[GDJW]2⦅単数で⦆
荘厳さ,荘重さ;尊厳,威厳:
- Mal[GDJW]1⦅複数はふつう -e⦆(皮膚の)
しみ,あざ;ほくろ;(Wundmal)傷跡:2⦅複数はふつう -e⦆〘スポーツ〙(競技場内の)マーク;(野球の)壘,ベース;(ラグビーの)ゴール.[GRIMM]signum; vices.
2) mal, künstlich erstelltes merkzeichen.
d) mal merkzeichen auf gewerblichen erzeugnissen:
mal merkzeichen auf geisteserzeugnisse übertragen:
e) mal, merkzeichen, denkzeichen in allgemeinerem sinne:
f) besonders das zu irgend einem andenken eigens errichtete zeichen (vergl. denkmal 1, th. 2, 941):
- Mangel足りないところ[GDJW]1(必要なものが)
欠けていること,欠如,不足,払底:2⦅ふつう複数で⦆a)(Fehler)欠陥,欠点:
- Manifestation公表(物)[GDJW]1(立場・主義などの)
表明,発表,声明;公表,公示.2 a) 顕現,あらわれ.b)〘医〙(症状の)発現,病徴:
- Mannigfaltigkeit多様態[GDJW]1(mannigfaltigなこと.例えば:)
多様性:
- Maßstab[GDJW]1 b)⦅比⦆(評価・判断の)尺度,
基準,規範:
- Material人材[GDJW]1
材料,素材,資材:
- Materie[GDJW]1⦅単数で⦆
物,物質;⦅理⦆物質;⦅哲⦆質料:2(研究・談話などの)題材,テーマ:
- Mechanismus[GDJW]1 a)
機械装置,メカニズム,機構,からくり.2) ⦅単数で⦆〘哲〙機械論:
- Meinung思いつき[GDJW]1 a)(英: opinion)意見,
考え,説:
- Menge多くの人びと[GDJW]2⦅単数で⦆多数の人,
群衆,集団,人ごみ,人の群れ:
- Menschheit多くの人びと[GDJW]2⦅単数で⦆多数の人,
群衆,集団,人ごみ,人の群れ:
- Messe[GDJW]1〘カトリック〙ミサ〔聖祭〕;〘楽〙ミサ曲: eine ~ halten〈lesen / zelebrieren〉ミサを行う〈執行する〉
- Métier機械みたいなもの[DAF]
Espèce de machine qui sert à certaines Manufactures.
- Miteigentum[GDJW](↔Alleineigentum)〘法〙共有〔財産〕.
- Mißbrauch勘違い[GDJW]1(権利・薬品などの)乱用,悪用:
[GRIMM]
abusus, disperditio.
1) die handlung des miszbrauchens, miszbräuchliches verfahren:
2) verkehrter oder schlechter brauch, im sing.:
- Mißtrauen[GDJW]不信〈疑惑〉:
- Mitglied[GDJW](団体の)構成員,メンバー(会員・団員・組合員・議員・委員など):(☞Angehörige)
- Mitleid[GDJW]同情,
思いやり,あわれみ:
- Mittelglied中間項[GDJW]3
〘論〙媒概念.4〘数〙中項:(☞Glied)
- Mobilie[GDJW]⦅ふつう複数で⦆(↔Immobilie)動産,
固定資産:
- Modalität様態性[GDJW]2〘哲〙(存在・出来事などの)
様相,様態.
- Modification変様[GDJW]3〘化〙
変態.
- Modus様態[GDJW]1(Art und Weise)
方法,方式,様式,仕方,やり方:(☞die Art und Weise)
- Mord[GDJW]1(英:murder)(故意の)
殺害,殺戮,殺人,人殺し;〘法〙謀殺(あらかじめ計画して人を殺すこと:→Totschlag)
- Mühe[GDJW]1苦労,
苦心,努力,骨折り:ex.) Das ist eine kleine 〈leichte〉 ~. それはおやすいご用です|(☞mühelos)
- Muß[GDJW]やむを得ない
〈せざるを得ない〉こと,必然;必要,不可欠;強制:
-
- Nachrede[GDJW]1
陰口,悪口,中傷,誹謗:übele ∼ ひどい悪口;〘法〙名誉棄損‖
- Nahrung[GDJW]1
〔飲〕食物,食餌,栄養;(植物にとっての)養分:
- Name[GDJW]1(英:name)名,名前;名称,呼称;名ばかりのもの,名目:名辞
- Nebensache副次事項[GDJW]1
副次的な〈瑣末な〉こと,枝葉末節:
- Neger[GDJW]
黒色人種,黒人:(特にアメリカの)黒人,二グロ;⦅比⦆被抑圧〈被搾取〉階級〔の人〕:
- Neid[GDJW]ねたみ,
そねみ;うらやましく思う気持ち,羨望:
- Nest[GDJW]2 a)(盗賊などの)巣窟,
隠れ家:
- Nichtigkeit〈無であること〉[GDJW]1⦅単数で⦆(nichtig なこと)a)
価値のなさ,つまらなさ:b)〘法〙無効:(☞ nichtig)
- nichts[GDJW]I⦅不定代名詞:無変化⦆(英:nothing)(↔etwas)何ひとつ…ない:
[GRIMM]
nichts, das negierte ichts (th. 42, 2035), hervorgegangen aus dem mhd. genetiv nihtes (md. nichtes), der dem substantivischen niht zur verstärkung und verallgemeinerung vorangesetzt wurde: nihtes niht, nihtesniht, ganz und gar nichts, durchaus nichts. schon im 14. jahrh. beginnt niht zu schwinden, so dasz der blosze genetiv nihtes, nihts übrig bleibt und in allen casus den begriff nihil ausdrückt (gramm. 3, 67 f. 777):
I. substantivisches zahlpronomen, nicht irgend etwas, nihil; oft zusammengestellt mit dem gegensatze ichts (th. 42, 2036):
II. seit dem 16. jahrh. wird nichts, das ursprünglich schon substantivischer natur ist, als unflectiertes (vergl. 5) substantiv mit dem artikel gebraucht: das nichts, ein nichts, nihilum.
1) als gegentheil des seins, als verneinung von etwas (ichts), das nichtsein (sich berührend mit 2):
a) in bezug auf das all (die leere, das chaos):
b) in bezug auf einzelnes:
das nichts ist entweder ein gar nichts, das reine absolute nichts oder ein verhältnismäsziges, relatives (auch privatives) nichts, s. Kant 1, 25 f. Hegel logik 1, 59 ff.
2) etwas nicht vorhandenes, ein unding und allgemeiner etwas wesenloses, nicht greifbares oder ein etwas, dem doch der eigentliche inhalt, das innere sein und leben fehlt, der blosze schein:
(☞ ichts)
- Not危急[GDJW]1 ⦅単数で⦆必要,
急迫:2窮乏,貧困;困窮,困苦,苦しみ;苦境,窮地:3 ⦅単数で⦆辛苦,苦労,やっかい:
[GRIMM]2) mit noth, mit groszer mühe und anstrengung, kaum, knapp (worin auch wieder der begriff der klemme liegt), s. A, I, 7, c:
A. noth substantivisch mit oder ohne artikel. / I. die noth ist zunächst und im allgemeinen das drängende, beengende und hemmende, sowie der (hilfsbedürftige) zustand des gedrängten, beengten und gehemmten; der rein sinnliche begriff des reibens bricht noch durch in nothfeuer (s. dasselbe); man vergleiche auch die sinnverwandten angst, klemme und zwang, die nebst andern synonymen oft mit noth verbunden werden.
7) das drückende, drängende und beengende der noth tritt auch in andern fällen von mehr abgeschwächter bedeutung hervor.
c) noth haben, grosze mühe haben, sich anstrengen müssen:
- Notigung強制[GDJW]1⦅ふつう単数で⦆nötigen すること:(☞nötigen)
- Notiz[GDJW]1⦅ふつう複数で⦆メモ,
覚書,手控え:
- Notrecht[GDJW]⦅スイス⦆=Notstandsrecht
- Notstandsrecht危急権[GDJW]〘法〙
緊急権
- Nutz[GDJW](Nutzen)
利益,有用:
- Nutzen[GDJW]
利益,有益,有用;効用利得,もうけ: von et.3 ∼ haben …で得をする|
- Nutzung[GDJW]⦅ふつう単数で⦆
利用;収益,〘法〙用益:
- Nutzungrecht[GDJW]〘法〙
利用権、用益権:
-
- Oberaufsicht[GDJW]〔総〕監督,
指導管理:
- Ohnmacht[GDJW]2無力,
無能力:
- Operation[GDJW]2(学問的な)操作,
処理,運用.4⦅数⦆演算.
- Opfer[GDJW]2(一般に)犠牲,犠牲的行為,犠牲者:
- Ordnung[GDJW]2⦅ふつう単数で⦆
順序よく並んでいること,きちんと〈整然と〉していること,整理〈整頓〉された状態,秩序;規律:4(ある体系を形作る)順序,序列,配列
- Organonオルガノン[GDJW]1 a)⦅単数で⦆(アリストテレスの)論理学.∇2(Organ)〘解・生〙器官,
臓器.
-
- Paroxysmus[GDJW]〘医〙発作,
激発;〘地〙激動期:
- Passivität受動態[GDJW]受動性,
消極性:(☞passiv)
- Pauke[GDJW]1(Kesselpauke)〘楽〙ティンパニ―;(半球形の)太鼓:mit ~n und Trompeten〘話〙鳴り物入りで,にぎやかに|[GRIMM]
1) im eigentlichen sinne, ein musikalisches schlaginstrument, sambuca, tympanum
- Phänomen[GDJW]1(Erscheinung)現象:
- Phantom[GDJW]1幻影,
まぼろし;幽霊,お化け:
- Pigment絵の具[GDJW]1(細胞液中の)色素:2(皮膚・紙・植物の葉などにある微細な)有色粒:3色粉,顔料:
- Plünderung[GDJW](plündern すること.例えば:)略奪.
- Platz[GDJW]∇4(Ort)(本拠のある)場所、地域、現地:
- Position[GDJW]6(Affirmation)肯定,
是認.7〘哲〙措定.
- Predigt[GDJW]1説教,
説法:
- Presenz現瞬間[DAF] PRÉSENCE
s. f. Existence d' une personne dans un lieu marqué.
On dit figurément, qu'Un homme a de la présence d'esprit, une grande présence d'esprit, pour dire, qu'Il a l'esprit vif et prompt, et qu'il dit et fait sur--le--champ ce qu'il y a de plus à propos à dire ou à faire. On lui a toujours remarqué beaucoup de présenced' esprit.
- Prätention[GDJW]2
思い上がり,尊大,傲慢:
- Privatbesitz[GDJW]私有;
私有物,私有財産:
- Privateigentum私有財産[GDJW] = Privatbesitz
- Produkt[GDJW]1産物,
生産品,製作物,製品;(一般に)所産,作品:
- Produktion
産物[GDJW]1 b)生産物,製造品;作品:(☞produzieren)
- Progreß[GDJW]前進,
進行,進歩:
- Proprietät[GDJW]1(Eigentum)所有物:2(Eingentumsrecht)所有権:
- Pulsation〘医〙
拍動,脈動:
-
- Qualification[GDJW]1資格
付与〔認定〕,格付け;〔価値〕判定,評価;〘法〙法政決定:
- Quelle[GDJW]2⦅比⦆a)(Ursprung)
根源,起源,源泉,源;もと,種(たね),原因:
-
- Rache[GDJW]1 a)復讐,
仕返し,報復:
- Rang[GDJW]1 a)(社会的・職業上の)
地位,身分,位階,官等,席次,序列:(☞Stellung, Zustand)
- Räsonnement[GDJW]1
理性的判断;推理;熟慮.2へ理屈.
- Rätsel[GDJW]1なぞ(謎),
なぞなぞ,クイズ,判じ物〈絵〉,字〈絵〉解き;⦅比⦆難題:
- Raub[GDJW]1
奪う〈奪われる〉こと,奪取,略奪,強奪,ひったくり;誘拐;搾取;横領,盗用;〘法〙強奪〈強盗〉罪:
- Realisation実在化[GDJW]
実現,現実化;〘商〙換金,現金化,売却.[fr.]
- Reaktion[GDJW]1 a)
反応,反響,反動,効果;〘化・心・生理〙反応,反作用:
- Rechnung[GDJW]2計算〔もんだい〕;⦅比⦆目算,思惑,見込み:
- Recht[GDJW]2recht daran tun⦅zu 不定詞(句)と⦆…するのは正しい:
[GRIMM]
I. recht, als subjectiver begriff.
4) recht, in allgemeinerem sinn, die irgend einem als folge seiner stellung zukommende befugnis und berechtigung:
a) als collectivbegriff, mit dem gen. des besitzers:
b) solches recht wird als gut, heilig, geheiligt bezeichnet:
c) recht, im gegensatz dazu als befugnis im einzelfalle; mit possessiven fürwörtern oder gen. des objects:
ein recht zu etwas, älter auch recht eines dinges:
e) recht, den sinn von anrecht, gegründeten anspruch (in rechtlichem oder sittlichem sinne) annehmend. es heiszt recht an einen oder etwas:
- Rechtfähigkeit[GDJW]〘法〙権利能力.
- Rechtfertigung[GDJW](rechtfertigenすること.例えば:)正当化,
正当性の理由づけ(証明);〘聖〙義認(神が罪ある人間を義とすること);弁明,釈明,申しひらき :
- Rechthaberei自権利主張[GDJW]常に自説〈自己の立場〉を正しいと主張すること,独善,頑固,ひとりよがり:[GRIMM]
das ungeordnete bestreben, recht zu haben oder recht zu behalten.
[DUDEN]rechthaberisches Verhalten
[DUDEN] rechthaberischstarr an seinem Standpunkt (als dem richtigen) festhaltend
- Rechtsgebot権利の進言(提言,提案,勧告)[GRIMM]
das anbieten der gerichtlichen schlichtung einer sache
- Rechtlichkeit正当性[GDJW](rechtlichなこと.例えば:)
合法性;誠実さ,正直:(☞rechtlich)
- Rede[GDJW]2⦅ふつう単数で⦆a)発言,話すこと:nicht der ∼ wert sein 言う〈とる〉に足りない:3 a)⦅ふつう単数で⦆話題,話のたね:ex.) Wovon ist die Rede? なんの話だ | von et.3 kann keine 〈nicht die〉Rede sein …は問題にならない.(☞reden)
- Reduktion[GDJW]2(Zurückführung)〘論〙還元法.3〘化〙還元.4〘生〙還元,退縮,退化.5〘数〙還元算,約分,換算.
- Reflex[GDJW]1(光・熱の)反射;⦅比⦆反映,
映像:
- Reflexion折れ返り,振り返り[GDJW]1 a)〘理〙(光・熱などの)反射.b):(一般に)反射;
反映.2反省,沈思,熟考: ∼en über et.4 anstellen …に関して省察〈反省〉を加える.[spätlat. -fr.]
- Regel[GDJW]1 b)⦅単数で⦆
習慣,通例:in der ∼ / in aller ∼通例〔は〕,ふつう:
- Regiment統治府[GDJW]2⦅ふつう単数で⦆統治,支配: [GRIMM]
1) regiment, wie regierung, in verschiedener anwendung. a) von fürsten und obrigkeiten, die leitung eines staates oder gemeinwesens:
d) regiment, gesamtheit von leitern eines staates oder gemeinwesens:
- Regreß[GDJW]2〘論〙後退,逆進:[lat.; <lat. re-gredī „zurück-schreiten‟ (◇Grad)]
- Regung[GDJW]3⦅雅⦆(Bewegung)動き,身動き:
- Reich国[GDJW]2 a)(一般に特定の)
世界,領域,支配圏:
- Reichtum[GDJW]1⦅単数で⦆(↔Armut)a)富,
裕福:
- Reife[GDJW]1(果物・穀物などの)成熟;(チーズ・ワインなどの)熟成;(動物・人間の)成熟;(一般に)円熟,熟達:
- Reiz[GDJW]1 刺激:
- Relation[GDJW]1 a)(Bezeihung)
関係,関連;[lat.;<lat. referre (→referieren)]
- Rest[GDJW]1(英:rest)
残り,残余;残部,残高、残金;⦅なごり⦆:
- Resultat帰結[GDJW](Ergebnis)
結果,成果;〘数〙(計算した結果の)答え:
- Retter[GDJW]救い手,
救助者:
- Richter[GDJW]1 a)裁判官,
判事:
- Richtigkeit[GDJW]1正しさ,
正確〈適格〉さ;正当,公正:et.1 hat seine ∼ / mit et.4 hat es seine ∼ …は正しい〈合っている〉
- Richtung[GDJW]1 a)方向,方角,向き;(Fahrtrichtung)(乗り物の)進行方向,進路,進路;(Verlauf)(道・川などの)延び,方向,道筋:
- Roheit粗雑[GDJW]1(roh なこと.特に:)粗野,
粗暴,残酷:
- Rubrik[GDJW]1 a)
〔朱書された〕標題、題目;欄、段、章、節;〔分類〕項目、見出し、部門、部類:
- Rückgang逆行[GDJW]1 b)〘天〙逆行運動(惑星が天球上を東から西に向かって進行すること):
- Rückkehr還帰[GDJW](zurückkehrenすること.例えば:)
帰還,復帰:
- Rücksicht[GDJW]1⦅単数で⦆
思いやり,配慮,気配り,斟酌,留意:aus 〈in / mit〉 ∼ auf jn. 〈et.4〉…のことを考えて,…を思いやって:ohne ∼ auf jn. 〈et.4〉…を顧みず,…のことをかまわず:
思い返す[GRIMM]f. das zurücksehen.
2) bildlich.
b) rückblick auf verhältnisse, dinge, personen, die für eine handlung oder einen entschlusz von bedeutung sind.
- Ruhe[GDJW]1(英:rest)(労働などのあとの)休息,いこい;休養,静養;(睡眠による)休息;(死後の)安息:2静止(状態);
停止:
- Ruhm[GDJW]1
名声,栄誉,ほまれ,栄光;∇(Rühmen)賞賛:
-
- Sache懸案の事柄,当の事柄[GDJW]1(事柄を表して)a) ①(Angelegenheit)事、事柄;事件;
事情,事態,事情,事実;〔案〕件,用件;問題:③⦅単数で⦆(話などの)中心となる事柄,本題,要点,核心,テーマ:c)(Rechtssache)〘法〙法律問題,司法事件;事案,件(→2 b)2⦅複数で⦆⦅ふつう形容詞・所有代名詞などと⦆(物を表して)a) ①物,品物;持ち物,所持品,身の回り〈手回り〉品,所有物;(特に:)衣類,家財道具:b)〘法〙物件(→1 c):
[GRIMM]
II. Bedeutung und gebrauch.
1) die älteste bedeutung des wortes wird seiner etymologischen verwandtschaft gemäsz 'streitigkeit, zwist' sein. gern wird es bezogen auf den vor dem richter zum austrag kommenden streit, den rechtshandel:
2) die quelle, das wesen, der grund des streits, der gerichtlichen verfolgung, der thatbestand, die schuld, das vergehen. fügungen wie das unter 1 erwähnte eine sache suchen vermitteln den übergang.
3) wesen und ursache des streits, des rechtshandels in der auffassung und darstellung des einen der betheiligten, die überzeugung, die er vertheidigend oder anklagend vertritt. so werden aus einer sache durch die verschiedene auffassung der parteien zwei sachen:
4) in weiterer entwicklung der vorigen bedeutung allgemein dasjenige, was jemand zu vertreten, zu vollbringen, zu thun hat, sein auftrag, seine aufgabe, seine pflicht, seine obliegenheit:
5) die bedeutung 3 verallgemeinert sich weiter zu der von 'angelegenheit' in allgemeinstem sinne. in ähnlicher weise entwickelt sich die bedeutung 1 zur umfassenderen von 'handel, geschäft, angelegenheit':
6) die bedeutung 2 wird ausgedehnt, indem das wort anwendung findet auf alles, was anlasz zu irgend einer verhandlung, erörterung bietet, was gegenstand derselben ist oder werden kann.
a) allgemein das wesentliche bei irgend einer verhandlung, einer erörterung, der gegenstand, der inhalt derselben oder ihr anlasz:
b) gegenstand, in sinnlicher bedeutung, soweit er anlasz zu streit oder verhandlung geben kann. sache wird vor allem gebraucht von dingen, die jemandes eigenthum sind, besonders von beweglichen, jedoch auch, zumal in älterer sprache, von liegenden gütern:
c) vorfall, geschehnis, that, thatsache:
- Schaden[GDJW]3(身体の〔不治の〕)
損傷,傷,障害,欠陥:
- Schein[GDJW]2⦅単数で⦆
外見,外観,見〔せ〕かけ,うわべ,体裁;〘哲〙仮象:zum Schein見せかけだけ:
- Scheu[GDJW](恐怖・自信のなさ・恥じらいなどからくる)
不安感,物おじ,しりごみ,遠慮,はばかり,臆病,内気;畏怖(の念):
- Schicksal[GDJW]2(個別的な)運命,
宿命,運,めぐり合わせ:
- Schicksalsdrama[GDJW]〘文芸〙運命
〔悲〕劇.
- Schlägerei[GDJW]殴り合い,
けんか,格闘:
- Schlußsatz[GDJW]2(Konklusion)〘論〙結論,
帰結,断案:
- Schmerz[GDJW]⦅肉体的な苦痛の場合はしばしば複数で⦆
痛み,疼痛,苦痛,苦悩,心痛:
- Schöpfer[GDJW]1 a)⦅雅⦆創造者,
創始〈創設〉者,創案者,〔創〕作者:b)⦅単数で⦆(Gott)神,造物主:
[GRIMM]
I. zu schöpfen, creare, creator, meist von gott gebraucht.
- Schöpferin創造する女神
[GRIMM]
die schöpft, weiblicher schöpfer; fem. zu schöpfer, doch nur in der bedeutung I gebräuchlich:
- Schöpfung[GDJW]1⦅単数で⦆(schöpfenすること.特に:)創造,
創作;創設,創始;(神による)〔天地〕創造:
- Schoß[GDJW]2 a)⦅雅⦆(Mutterleib)母胎;
⦅比⦆内部,内奥:
- Schranke[GDJW]1(障害・仕切り用の)横木,遮断棒;さく,垣,格子;(Bahnschranke)〘鉄道〙(踏切の)遮断機;(法廷の裁判席と傍聴席とを仕切る)手すり;(試合場の)矢来;通行料金取立所:3⦅ふつう複数で⦆
限界,制限;障壁:
- Schuld罪責,有罪[GDJW]1 a)⦅単数で⦆罪,
とが,責任;(精神的な)負担,負い目;⦅雅⦆恩義,義理:b)⦅ときに小文字で:→schuld⦆an et.3 schuld haben …について罪(責任)がある|2⦅ふつう複数で⦆借金,借財,負債,債務;貸金:(☞Unschuld)
- Schuldner[GDJW]1(↔Gläubiger)債務者:
- Schuß[GDJW]1 a)⦅数詞を伴って数量を示す場合,複数は単数と同形⦆(英:shot)(弓・火器などの)射撃,発射,発砲;射程,着弾距離;(一発分の)銃〈砲〉弾,弾薬;発射〈射撃〉音、銃声;銃創:(ex.) jm. vor〈in〉 den ~ kommen 〘狩〙(獲物が)…の射程内に入る;⦅話⦆(会いたいと思っていた人と)…がばったり出会う| Er kam 〈lief〉mir in den ~. 私は彼とちょうどいい時に出会った|[GRIMM]
handlung des schieszens, den verschiedenen bedeutungen des verbs entsprechend.
II. zum transitiven schieszen.
1) eigentlich, das fortschleudern eines geschosses:
g) besonders üblich sind gewisse feste verbindungen, meist als jagdausdrücke, so besonders zum schusse kommen, von dem schieszenden:
meist in freierem sinne, einem in den weg laufen, begegnen, gelegen kommen, vgl. Borchart2 s. 430: aber soll mir der dintenklekser einmal in den schusz laufen? Schiller kab. u. l. 2, 4;
- Schutz[GDJW]1⦅単数で⦆保護,
庇護;後援;援護,護衛;防護,防御,防衛;予防:
- Schwäche[GDJW]2
〔ひ〕弱さ,もろさ;弱み,弱点,短所:
- Seele[GDJW]1(↔Leib)a)(英:soul)
心:b);〘宗〙霊〔魂〕:
- Seite[GDJW]
1 a)(英:side)(Flanke)(左右の)側面,
横腹,横手,側方:(人間・馬などの)脇腹,横腹、わき;⦅比⦆かたわら,そば:
d)⦅単数で⦆(離れた)わき〔の方〕,かたわら:et.4 auf die ∼ räumen〈legen / schaffen / stellen>…を取りのける,…を片づける|
2 a)(物の)〔側〕面:3 a)(立体の)面;(平面図形の)辺.b)(方程式などの左右の)辺,項.
- Selbsterhaltung自己維持[GDJW]
自己保存:(☞ erhalten)
- sich☞aus sich,bei sich,in sich,mit sich,vor sich
- Sicherheit[GDJW]1⦅単数で⦆安全,
無事,無難;(国家の)安全保障:
- sie[GDJW]I 2⦅不特定の人びとを示して⦆(man)(世の)人;みんな;連中:
- Sieg[GDJW](戦闘・戦争での)勝利,
戦勝;(競争・競技などでの)勝ち,勝利;(さまざまな困難・障害に対する)勝利,克服,征服:
- Sinn感じ(方)[GDJW]2⦅単数で⦆(特定の事物を理解する)
感覚,センス,感受性:4⦅単数で⦆意味;意義;趣旨:極意
[GRIMM]
7) häufig bezeichnet sinn in verbindung mit adjectiven die gesinnung, das gemüt oder den character:
10) sinn in verbindung mit adjectiven und verben (als object), wobei oft schon eine spezialisierung der bedeutung eintritt (vgl. die nächsten abschnitte):
22) in neuerer zeit ist sinn nur noch üblich und sehr gewöhnlich von der bedeutung, meinung, dem geistigen gehalte, der tendenz einer äuszerung, eines werkes oder (seltner) einer handlung im gegensatze zu ihrem wortlaut bezw. ihrer äuszern erscheinung:
a) sinn einer rede, äuszerung:
b) daher werden häufig sinn und wort (wortlaut, auch buchstabe) in gegensatz gestellt;
c) sinn haben, etwas bedeuten:
andre stellen nähern sich mehr der gewöhnlichen subjectiven bedeutung von sinn (vgl. 7 und 10):
d) sehr häufig werden mehrere sinne unterschieden, sowohl mehrere bedeutungen z. b. eines wortes (z. b. Notker ps. 118, 4 unter a, jetzt weniger üblich), als auch besonders mehrere auffassungsweisen. namentlich wird gern dem wörtlichen oder buchstäblichen sinne ein freierer, geistiger, bildlicher, innerer, geheimer sinn u. ähnl. gegenübergestellt:
(☞ Bedeutung)
- Sitz[GDJW]4 a)居所,所在地;中枢:seinen ~ in Paris haben 本拠がパリにある:
- Sklaverei[GDJW]1
奴隷状態,奴隷の身分;奴隷制,極度の圧政〈暴圧〉を受けること:
- Skulptur[GDJW]2
彫刻品,彫像:
- Soll[GDJW]1(↔ Haben)〘商〙借り〔高〕;〘簿〙借方(複式簿記の左の欄);⦅比⦆負債:
- Sollicitation誘い出し[DAF]
SOLLICITATION. subs. f. Action de solliciter.
(☞sollicitiren)
- Spaltung[GDJW]1(〔sich〕 spalten すること.例えば:)分割,
分裂;(化合物の)分解;〘鉱〙(結晶の)劈開:〘理〙(ラセミ体の)分割;(耐火物の)スポーリング;〘紋〙(盾面の)縦〔2〕分割:2(spalten された状態.例えば:)(国土などの)分裂〔した状態〕;不和:
- Speise[GDJW]1(調理された)
食物,料理:
- Sphäre[GDJW]2領域;
視野;勢力圏,活動範囲,領分:
- Spitze[GDJW]1 a)(とがった)
先,先端;(刃物の)切っ先;(先細りになったものの)先端;(山などの)頂,頂点;(統計カーブなどの)ピーク:
- Sprache[GDJW]3⦅単数で⦆話し方,
物の言い方,言葉づかい,表現法,用語〔法〕;発音〔の仕方〕〘劇〙せりふ:4⦅単数で⦆話すこと,発言
- Spur[GDJW]2⦅ふつう複数で⦆痕跡,
あとかた,なごり:
- Standpunkt[GDJW]1
観察位置:2立場,立脚地,見地,観点;見解,意見,考え方:
- Stärke[GDJW]1(物理的・肉体的・精神的な)強さ,
強度;強いこと:
- Stelle[GDJW]1 b)(Ort)(しかるべき・特定の)場所;
(Baustelle)〔建築〕敷地,地所:c)⦅単数で⦆⦅比⦆代理;立場,境遇:an ∼ von jm. 〈et.3〉…に代えて,…に代わって(→anstelle)|
- Stellung[GDJW]1 a)(Haltung)姿勢;
(フェンシングなどの)構え:3(Stelle)地位,身分;勤め口,職(場):(☞Rang, Zustand)
- Stoff[GDJW]2(芸術上・学術上などの)素材,
題材,テーマ;材料,質料:3物質,実質;要素,成分;材料,原料:
- Strafe[GDJW]1 a)
罰,刑罰,処罰,懲罰:
- Streit[GDJW]1争い,
いさかい,けんか,抗争,確執;(意見などの)衝突:
- Strom大河[GDJW]1 a)(英:stream)(大きな)川〔の流れ〕:
- Stück
[GRIMM]
ε) von (aus, an) éinem stück drückt ein continuierliches, ununterbrochenes, unabgeteiltes, sowohl räumlich als zeitlich, aus.
[/] räumlich meist von handwerklichen und künstlerischen hervorbringungen:
oft uneigentlich, formelhaft von literarischen werken, 'aus einem gusz':
[GDJW] Guß1〘金属〙a)鋳造,鋳込み:〔wie〕 aus einem ~ sein ⦅比⦆(作品などが)渾然一体としている.
- Studium[GDJW]1⦅単数で⦆(大学での)勉学:
- Stufe[GDJW]2段階,
程度;階層,等級,階級:
- Stufenleiter階梯[GDJW]2〘生〙(生物の下等から高等への)段階系列:
- Stütze[GDJW]1支え,
支柱,突っ張り;足場,土台;支持器具;⦅比⦆よりどころ,頼り,助け:
- Substrat敷地[GDJW]1
土台,根底,基礎;下層,基層.2〘化〙基質.3(Nährboden)培地,養基.4〘農〙下層土,底土.5〘哲〙基体,実体:6(↔Superstrat)〘言〙下層,基層(被征服民族の言語)[mlat.: < lat. sub-sternere „unter-legen“ (◇streuen)](☞ unter|legen)
[LDB]
Substrãtus, um, m. (von Substerno) das Unterstreuen, Unterlegen, z. E. eulmum fragunt substratu (statt substrarui) animalium, i. e. ut substernatur animalibus, Plin. H. N. XVIII, 30 post init. sect. 721: vitices suffitu atque substratu fugant venenata, Ibid. XXIIII, 9 ante med. sect. 38.
- Substanz[GDJW]1(Stoff)
物質;2実質,内容、中身;実体,本質:3 a)〘商〙資産,資本;元金,元本:4〘哲〙実体.[lat. substantia „Bestand“ — mhd.; <lat. stāre (→stehen)]
[GRIMM]
substanz, f. , geht auf lat. substantia zurück, das eine übersetzung von gr. ὑποκείμενον, ὑπόστασις, οὐσία ist, s. Eisler hwb. d. philos. (1922) 640;
für den in der theologie des mittelalters geläufigen philosophischen begriff finden sich an verdeutschungen seit dem ahd. wesan, wesen, vgl. Seiler lehnw. 2, 6 (s. auch unten synonymen gebrauch neben substanz), bei Frauenlob understende minneleich 15, 5;
seit dem mhd. selpwesen, selb(st)wesen bis zu Leibniz, s. teil 10, 1, 503, seit dem 16. jh. bis zu Leibniz auch selb(st)stand, s. teil 10, 1, 492.
1) im philosophischen sinne, der dem ursprunge des wortes und begriffes gemäsz auch im dt. am ältesten und am breitesten entwickelt ist, bedeutet substanz das den wechselnden phänomenen 'unterliegende', das als beharrlich, zugleich meist als träger der eigenschaften, als selbständig für sich seiendes gedacht wird, s. Eiser hwb. d. philos. (1922) 640.
a) im gefolge der aristotelischen auffassung wird substanz gefaszt als ein einzelnes, einer bestimmten erscheinung als wesentlich zugrunde liegendes; die mittelalterliche vorstellungsart veranschaulicht der vergleich, den die person der ewigen weisheit dem menschen vorlegt:
b) seit der popularisierung Spinozas versteht man unter substanz zunächst das allgemeine substrat alles seienden: das urseyn, das allgegenwärtige unwandelbare wirkliche, welches selbst keine eigenschaft seyn kann, sondern an dem alles andre nur eigenschaft ist, die es hat, dieses einzige unendliche wesen aller wesen nennt Spinoza gott oder die substanz F. H. Jacobi üb. d. lehre des Spinoza (1785) 128 f.;
- Sühne[GDJW]⦅雅⦆
償い,あがない,罪滅ぼし,贖罪:
- Synthesis = Synthese総合命題[GDJW]1 b)〘哲〙(ヘーゲル弁証法における These と Antithese の)総合./li>
-
- Talent[GDJW]1(生まれつきの)才能,
能力,天賦の才,資質:
- Tätigkeit[GDJW]1
働き,仕事,活動,行動;(職業としての)仕事:
- Tatumstand事情
[DUDEN]
in Zusammenhang mit einer Straftat stehender Umstand
- Tausch[GDJW]交換;(Tauschgeschäft)交易,貿易:
- Tausend[GDJW]I 2⦅比⦆多数〔の〕,無数〔の〕:
- Teil[GDJW]I(全体の)一部,部分:zum ∼ (略⃝ z.T.)部分的に,一部は|III(Partei)〘法〙(契約・訴訟などの)当事者:IV(Anteil)分け前,取り分;(関与すべき)割り当て分,責任分担分:
[GRIMM]
2) die eine von zwei parteien
c) mein, dein, sein u. s. w. theil, meine seite, meine person, ich u. s. w. (mit oder ohne den nebenbegriff des gegensatzes zu andern).
β) auf, zu meinem theil, für meinen (mein) u. s. w. theil, was mich betrifft, meinerseits: ich an meinen theil gestehe, dasz ... Wieland 29, 493;
- Teilung[GDJW](〔sich〕 teilen すること.例えば:)1分割,
区分;分割〈区分〉目盛り;分岐;分配;配分:
- Tempel[GDJW](キリスト教以外の宗教の)神殿,
寺院,聖堂;⦅比⦆(神聖な)殿堂:
- Titel[GDJW]2 a称号,
肩書:
- Ton論調[GDJW]4⦅単数で⦆
話し方,口調,語調,語気;文章スタイル,文体:
[GRIMM]
8) ton bezieht sich auf ausdruck und inhalt der rede in wort und schrift, in verkehr und umgang, in empfindungsweise und denkart. schon aus der mittelalterlichen verwendung von ton als 'melodie' haben sich übertragene gebrauchsweisen von ton ergeben, ja schon der älteste beleg aus der Milstäter genesis berichtet, von den brüdern Josephs:
m) der ton entspricht einer bestimmten kunstgattung und geistesrichtung.
δ) der philosophische, dogmatische, satirische, polemische ton:
- Totalität[GDJW]1
全体〔性〕;⦅哲⦆総体〈全体〉性:
- Tötung[GDJW]⦅ふつう単数で⦆(töten すること.例えば:)1殺害;
〘法〙殺人〔罪〕:
- Trennung[GDJW](trennen すること.例えば:)
切断;分離;分割;分岐;離別,別居,決別,解散;離脱,分派:区分,区別;〖言〗分綴;〖化〗分離:
- Trompeter[GDJW]トランペット奏者;〘軍〙らっぱ手.[GRIMM]
TROMPETER, trommeter, m. abgeleitet vom subst. trompete oder dem verb trompeten, seit dem anfang d. 15. jhs. belegt;
1) 'bläser der trompete',
a) für den trompetenbläser im heere und beim turnier.
β) in besonderer verwendung als bote, befehlsübermittler, unterhändler u. s. w. gebraucht, worin sich noch die alte funktion des herolds spiegelt:
b) für den als ausrufer, herold, vorreiter, begleiter von standespersonen, des herolds u. s. w. bediensteten trompetenbläser,
d) da die trompeter früher zum dienstpersonal gehörten, galt ihre soziale stellung als gering (vgl. trompetertisch), ihr beruf als ärmlich und aufreibend (eine ausnahme machten zeitweise die hof- und feldtrompeter,
2) in übertragener verwendung für personen, die geräuschvoll für eine sache eintreten,
- Trost[GDJW]慰め,
慰安;慰めを与えてくれる(()元気づけてくれる)もの:
- Tyrannei専制[GDJW]1〘史〙(古代ギリシアの)僭主政治;(一般に)専制政治,
暴政,虐政:
-
- Übel害悪[GDJW]II 1
悪,害,災い;災害,不幸:[GRIMM]1) im allgemeinsten sinne: alles, was dem guten als dem sittlich gebotenen, zweckmäszigen, angenehmen, gesunden entgegen steht; also das princip des bösen, schädlichen, der sünde, des leidens im philosophischen, physischen, moralischen und socialen verstande.
- Übereinstimmung[GDJW]1
一致,合致,同意見、合意:2⦅mit et.3⦆(…と)調和している,(…と)よく合っている:
- Überfluß蛇足[GDJW]2余計なこと:
- Übergang[GDJW]3 a)(ある状態から他の状態への)移行,
経過,変更;過渡期,〔季節の〕変わり目;過渡的〈一時的〉なもの:
- Übermaß[GDJW]1⦅単数で⦆過度,
過量,過剰,過多:
- Überzeugung[GDJW]
確信,信念,信条,主義:
- Umfang[GDJW]2 a)
かさ,大きさ,(総)量,ひろがり,範囲;〖商〗(保険の)補償範囲:
- Umkehrung[GDJW](umkehren すること.例えば:)
逆戻り;裏返し:〘理〙反転;〘化〙転化;〘楽〙転回〔形〕:(☞ umkehren)
- Umkreis[GDJW]1⦅単数で⦆(一定の広さの)
周辺地域,周囲;〖商〗(保険の)補償範囲:
- Umstand附帯状況[GDJW]1(英:circumstance)
事情,事態,状況,境遇;〘法〙情状:[DUDEN]1. zu einem Sachverhalt, einer Situation, zu bestimmten Verhältnissen, zu einem Geschehen beitragende oder dafür mehr oder weniger wichtige Einzelheit, einzelne Tatsache [Synonyme zu Umstand: Begleitumstand, Element, Faktor, Gesichtspunkt, Moment, Tatsache; (bildungssprachlich) Aspekt]
- Unfug[GDJW]2(Unsinn)ばかげたこと:
- Unglück[GDJW]2⦅単数で⦆(Elend, Unheit)不幸,
ふしあわせ;わざわい,災難,災厄;(Mißgeschick)不運,悪いめぐりあわせ,不首尾,不成功,へま:
- Universum[GDJW]2(Weltall)宇宙、万有;
⦅比⦆無限の多様性.[lat.; < lat. ūni-versus „in eines gekehrt, gesammt“ (◊vertieren2)]
- Unschuld無罪責[GDJW]1罪〈責任〉のないこと,無罪,無実,潔白:(☞Schuld)
- Untergang[GDJW]2 b)⦅比⦆没落、破滅、滅亡;
零落;堕落:
- Unterordnung[GDJW]2 a)下位区分.
- Unterscheiden区別する(こと)[GDJW]I 1区別する、
類別する;識別〈判別・弁別〉する、見〈聞き〉分ける:
- Unterscheidung[GDJW]1⦅単数で⦆unterscheiden すること.2 = Unterschied 2
- Unterschied[GDJW]1 a)
相違(点),差異,違い:2(Unterscheidung)区別〔付け〕,差別〔だて〕:(☞Differenz)
[GRIMM]
II. bedeutung und gebrauch. die entwicklung folgt der des verbums unterscheiden.
4) nach unterscheiden II 1, 2 ergibt sich die vorstellung der trennung, sonderung, verschiedenheit, des andersseins, ohne dasz begriffliche abgrenzung im e. sinne beabsichtigt ist.
9) unterscheiden III 4 entsprechend, thätigkeit und ergebnis eines gedanklichen, begrifflichen, wesenhaften, wissenschaftlichen, terminologischen unterscheidens.
a) handlung und fähigkeit des unterscheidens.
b) inbegriff der unterscheidenden, charakteristischen merkmale, wesentliche eigenschaft, bezeichnender umstand, zug u. ä.:
c) wissenschaftlich und terminologisch. sprachwissenschaftlich:
d) die bed. schwächt sich in manchen verbindungen erheblich ab, verallgemeinert sich und verschmilzt mit bed. 4:
(☞unterscheiden)
- Ursache[GDJW]原因,
もと;理由,動機,いわれ:
- Ursächlichkeit[GDJW]⦅ふつう単数で⦆原因性,因果関係:
- Ursprünglichkeit根源態[GDJW]ursprünglich なこと.(☞ursprünglich)
-
- Vatermörder[GDJW]1父親殺し(人):
- Veranlassung[GDJW]2(Anlaß)誘因,動機,きっかけ:
- Veranstaltungちょっとした会合[GDJW]1⦅単数で⦆veranstaltenすること:Vgl. veranstalten 2
催し〔もの〕,行事:
- Verbindung[GDJW]2(vermbindenされた状態.例えば:)a)結合,
結びつき,連結,接合;接続;連絡;連関,関連,関係:
- Verbindlichkeit[GDJW]2 a)⦅単数で⦆(約束・契約などの)拘束力;
〘法〙覊束力:
- Verbrauch[GDJW]消費〔量〕;消耗,
摩滅,損耗:
- Verbrechen[GDJW]犯罪;
犯罪的な〈恥ずべき〉行為;〘法〙重罪(→Übertretung, Vergehen):
- Verbrecher[GDJW]犯罪者;(犯罪を犯した)
犯人:
- Verdienst[GDJW]II功績,
功労,てがら:
- Verdrießlichkeit[GDJW]2⦅ふつう複数で⦆面倒
〈やっかい〉な事柄:
- Vereinigung統一化(する)[GDJW]1(〔sich〕vereinigenすること.例えば:)
合一,一体化,結合,統合,連合,合併,合同;(土地の)合筆,併合;集中;提携,協同;一致,調和:(☞vereinigen)
- Verfahren[GDJW]IV 2やり方,
仕方;態度,振舞い;(作業や処理などの)方法,方式:
- Vergewisserung〓[GDJW]
確認:[GRIMM]f. bestätigung, feststellung: wiszung et wiszerung in usu quidem non sunt sed vergewissung, vergewisserung affirmatio, asservatio vulgo certioratio, eidliche vergewisserung affirmatio religiosa Stieler 567;
[DUDEN]1das Sichvergewissern
Vgl. vergewissern
- Vergleichung[GDJW](vergleichen すること.例えば:)比較;
対比、照合;参照:
- Vergnügung[GDJW]⦅ふつう複数で⦆楽しみ,
気晴らし,娯楽;娯楽の催し,パーティー:
- Verhältnis関わりあい[GDJW]2 a)
〔対人〕関係,間柄;内面的な関係,親近感,理解:in einem freundschaftlichen 〈gespannten〉 ∼ zu jm. stehen …と親しい〈緊張した〉関係にある,…と仲がいい〈悪い〉|
- Verkennung[GDJW]
見誤り,見そこない,誤認,誤解:
- Verkehrung顚倒(する,させる)[GDJW](verkehren II すること.例えば:)
間違い;本末転倒:
- Verknüpfung[GDJW](verknüpfen する・していること.例えば:)
結合,結びつき.
- Verletzung侵害[GDJW]1
傷害;損傷,負傷,傷〔口〕,けが:2 b)違反;侵犯;不履行:(☞verletzen)
- Verlust[GDJW](verlieren すること.例えば:)喪失;
紛失;むだ遣い,浪費;敗北:
- Vermögen資産能力[GDJW]II 1⦅単数で⦆能力,力:II 2 a)財産,資産:
- Vermundschaft[GDJW]〘法〙後見:
- Vermutung言い分[GDJW]
推測,推察,推量,想像;予想,予期:(☞vermuten)
- Verpflichtung束縛、義務づけ[GDJW]2 a)
義務,責務:[GRIMM]f. vereinigung, verbindlichkeit.
(☞verpflichten)
- Verrücktheit狂い[GDJW]1verrückt なこと:
- Verschiedenheit違い[GDJW](verschiden なこと.例えば:)
相違、差異:
- Verschwörung[GDJW]2陰謀,
〔共同〕謀議,謀略;謀反の企て:
- Verwicklung, Verwickelung[GDJW]2もつれ,混乱,
紛糾,いざこざ,面倒:[GRIMM]2) übertragen.
a) unlösliche bindung, verstrickung:
verwicklung mit und in etwas:
die kraft des opfers besteht in dem anschauen und objektiviren der verwickelung mit dem unorganischen Hegel w. 1, 386;
~ mit …との絡みあい
- Verwundung傷害[GDJW]負傷,
けが
- Verzicht拒絶[GDJW]II 1
断念,放棄,棄権:auf et.4 ~ leisten 〈üben〉…をあきらめる,…を断念する;…を放棄する[GRIMM]B ... 1) im sinne einer ablehnenden willenshaltung
- Vielfache[GDJW]1
何倍もの数量:2〘数〙倍数:
- Vollbringung完成,
全うすること[GDJW](vollbringenすること)遂行,成就:
- Vollendung完結すること[GDJW]1sich vollenden すること:
- Vollständigkeit完備(していること)[GDJW] vollständig なこと:(☞vollständig)
- Vorfahr直系尊属[GDJW]1(直系の)
先祖(父母・祖父母・曾祖父母など):
- Vorgang[GDJW]∇4先例,
模範:
- Vorrecht[GDJW]
特権,優先権,特典
- Vorsatz[GDJW]1
意図,企図;〘法〙故意:(☞Absicht)
- Vorschein再現[GDJW]⦅もっぱら次の形で⦆zum Vorschein kommen
出現,現れる:[GRIMM]3) in fester verbindung zum vorschein kommen: zum vorschein kommen, comparire, apparere Kramer teutschital. dict. 2 (1702) 495a;
a) von personen; zunächst in eigentlichem sinne, sichtbar werden, sich dem auge darbieten, während sie vorher überhaupt oder eine zeit lang nicht gesehen werden konnten; ein ins wasser gefallener kommt wieder zum vorschein (Campe);
4) zum vorschein kommen auf unbelebtes bezogen.
a) im eigentlichen sinne sichtbar werden, nach einem zustande des verborgen seins:
- Vorsorge[GDJW]あらかじめの配慮,
用心,将来への準備,万一の備え:
- Vorsteher[GDJW](Vorstehenする人.例えば:)
部局長,責任者,統括者,管理責任者,主任;(スイスの)大臣.:
- Vorteil利得[GDJW]
利益,有利,得,好都合;長所,利点: Vor- und Nachteile 利害得失|[KS]利得,もうけ,長所;凌駕,優(卓)越:(☞Interesse)
- Vortrag講義[GDJW]1講演:(☞vortragen)
- Vortrefflichkeitすばらしさ[GDJW]vortrefflich なこと.(☞vortrefflich)
- Vorzug[GDJW]2⦅単数で⦆
他よりも好むこと,好み;優位,優先:
-
- Waage[GDJW]1はかり,計量器(→図);(Wasserwaage)レベル,水準器;⦅比⦆価値を評価(決定)するもの;考量;(運命の)裁定;(Gleichgewicht)平衡,均衡,つり合い:
[GRIMM]
III. gewicht, instrument zum wägen u. s. w. ein gemeingermanisches wort, das aber im gotischen nicht belegt ist:
ndl. waag
die schreibung waage wird schon von Adelung verworfen, doch ist sie noch jetzt hie und da üblich (um den plur. von wagen 'currus' zu sondern).
5) besonders zu besprechen sind einige bildliche verwendungsweisen, aus denen sich neue, feststehende bedeutungen von wage entwickelt haben.
a) wage in der entwicklung zu 'gleichgewicht, wagerechte lage'.
α) gleiche wage halten ist die wagschalen so halten, dasz sie in gleicher linie liegen und gleichgewicht herrscht. bildlich:
einem gleiche wage halten ist 'einem andern gegenüber seine sache auf gleicher höhe zu behaupten wissen', also 'ihm das gleichgewicht halten':
錘
- Wasserigkeit水気[GDJW]wasserig なこと.:
- Wecksel[GDJW]I 1 a)⦅ふつう単数で⦆
交代,交替,入れ替わり;交換,取り換え;移り変わり,変転;転換;変化,変動:
- Weckselbestimmung交換規定[GRIMM]
f. wechselseitige bestimmung Fichte grundl. der wissenschaftsl. 57; die w. des endlichen und unendlichen Hegel 3, 153;
- Weckselbeziehung交換関係[GDJW]
相互関係,相関関係[GRIMM]f. wechselseitige beziehung:
mit gen.: der form und des wesens Hegel 4, 80;
- Weg[GDJW]1(英:way)道,
道路:通路;道順,(発展などの)過程;道のり,旅路;(歴史などの)歩み,人生行路,(天体の)軌道;⦅話⦆(買い物のための)外出,用足し:
- den Weg machen道程となる
[GRIMM]
-
- die ursprünglichen bedeutungen.
- ) weg kann dann überhaupt eine strecke sein, auf dem sich etwas einem ziele zu fortbewegt, ohne dasz es auf die beschaffenheit dieser strecke ankommt. die strecke kann über mehrere gebahnte straszen hinweggehen (z. b. der weg nach Rom), sie kann aber auch ungebahnt sein (z. b. der weg durch die wüste), überall kommt es darauf an, dasz eine bestimmte richtung nach einem ziele zu verfolgt wird.
- ) das unter 2 besprochene weg kann in vielen fällen auch abstract genommen werden. so kann ein weiter weg eine ausgedehnte strecke oder auch eine lange reise sein, ein gerader weg eine strecke in gerader linie oder eine in gerader richtung fortgesetzte fahrt;
- ) weg nimmt in der nordd. umgangssprache die bed. 'ausgang zu einem bestimmten zweck, besorgung, einkauf' u. dgl. an Müller-Fraureuth a. a. o.:
- feste verbindungen mit verben, die auch in übertragenem gebrauch vorkommen.
- ) weg als accusativisches object, meist in der zweiten bedeutung.
- ) den weg machen ist erst in der neueren sprache häufiger (vgl. auch A 3 d):
- Weide[GDJW]1(放牧に適した)牧草地,
放牧場,牧場;(魚・鳥などの)餌場:
- Weise2あり方[GDJW]1(英:wise)
やり方,仕方,方法,流儀,…ふう:
[GRIMM]
A. weise des menschen, besondere beschaffenheit und eigenart seines seins und handelns, 'natürliche art, wesensart' (= genus, natura) und 'weise, handlungsweise' (= modus, ratio, habitus). im allgemeinen bedeutet weise im gegensatz zu art (s. teil 1, 568) 'handlungsweise' (= modus), gibt also die besondere weise des tuns und verhaltens an, wobei die art, durch die das verhalten bestimmt ist, mehr oder weniger deutlich einbegriffen ist. die bedeutung 'art' (= genus, natura) ist wenig häufig und klar entwickelt, sie kommt mehr dem wort art zu.
1) 'die verhaltensweise, handlungsweise' des menschen (= modus, habitus, forma, consuetudo, mos), entsprechend auch von gott. verschiedene stufen: die durch die natürliche art hervorgerufene gesamthaltung, mit genus stark verwandt; die lebensart, sitte, gewohnheit, die art und weise eines besonderen tuns, handelns, gelegentlich auf ein bestimmtes gebiet eingeschränkt (weise in der sprache), ein durch besondere lage und umstände hervorgerufenes benehmen; auch äuszere gestalt, aussehen. seltener vom tier.
c) mit genetivattribut. / β) die weise wird in ihrer sachlichen besonderheit durch einen genetiv bestimmt, z. b. weise der baukunst = weise des bauens, weise zu bauen; manche dieser fälle kommen dem objektiven gebrauch (B) nahe, sodasz die grenze oft schwer zu ziehen ist [...]
d) mit abhängigem infinitiv. / β) zur näheren bestimmung der sachlichen besonderheit der weise, in der eine person handelt, z. b. die weise zu leben, die besondere lebensweise eines wesens; häufig sich dem objektiven gebrauch (B) nähernd (vgl. auch oben A 2 c β)
2) bestimmte anwendungen. / a) in einem besonderen theologisch mystischen sinne bedeutet mhd. wîse das menschliche sein, soweit es tätigkeit, wirken, äuszerung der höheren und niederen seelenkräfte und der sinne ist (modus essendi), im gegensatz zum wîselôsen zustand des aufgegangenseins in den seelengrund bei der unio mystica und zum reinen sein gottes:
b) künstlerische weise, die besondere, einen künstler kennzeichnende eigenart:
c) zustand, in dem ein mensch sich befindet; in formelhaften wendungen:
d) als puristischer ausdruck für lat. modus in der grammatischen fachsprache des 17./18. jhs.:
B. objektiv, eine bestimmte, festgelegte form des tuns, die vom handelnden vollzogen und befolgt wird, aus einsicht in die notwendigkeit, durch gewohnheit, vorschrift, sitte u. s. w. mit dem vorigen (A 1, 'handlungsweise' vor allem A 1 c β und A 1 d β) verwandt und in einzelnen fällen nicht streng davon zu trennen; die nähere bestimmung und erweiterung wird syntaktisch in gleicher weise wie bei A angefügt.
(☞die Art und Weise, Zustand)
- Weisheit[GDJW]1⦅単数で⦆
賢いこと,賢明,聡明;知恵,英知,明察,分別,思慮;学識,見識;
- Wesentlichkeit本質的なところ[GRIMM]
1) 'essenz, essentialität', vom göttlichen wesen (zu wesentlich 1);
- Wendung言い回し[GDJW]3(Redewendung)言いまわし,語法,表現法:
[GRIMM]
- ) oft bezeichnet wendung weniger den vorgang als das dadurch erreichte ergebnis (ähnlich bereits eine wendung geben u. dgl. unter 1 c)
- ) wie früher bezeugtes redewendung (s. teil 8, 475 u. vgl. auch wortwendung tropus Orsäus nomencl. meth. [1623] 17), das ebenso wie einige genitivische fügungen den ursprünglich mit wendung (phrasis) verbundenen vorgangsbegriff erkennen läszt; hingewiesen sei insbesondere auf wendung der wörter:
- wenig[GDJW]I⦅不定数詞・不定代名詞として用いられ,付加語的用法では2格を除いて無語尾のことも多い⦆3⦅副詞的⦆a)⦅準否定詞として⦆少し〈わずか〉しか…でない,あまり〈ほとんど〉…でない:
[GRIMM]
II. indefinite umfangs- oder mengebezeichnung.
A. als grundstufe (positiv). schon im frühen mhd. erscheint wenig als gegensatzbezeichnung von viel, älteres lützel allmählich zurückdrängend (s. teil 6, 1354 ff. sowie die belege bei Alfr. Hübner die 'mhd. ironie' oder die litotes im altdt. [1930], insbes. 20 ff., 138 ff. und 153 ff.).
1) mit bezug auf den kleinen umfang, die geringe menge oder stärke einer wesenheit.
c) aus undeutlichen genitivfügungen wie wenig sorg
Klara Buddenbrook ... besasz ohne zweifel höchst wenig mütterliches talent (1901) Th. Mann Buddenbrooks 372 in: ges. w. (1955) 1;
III. rang oder werthöhe angebendes prädikat.
2) wie minder (teil 6, 2224 f.) findet sich weniger früh beim wertenden, rangabstufenden vergleich:
ein schlechter kerl, der sich an weiber und musikanten wagt, die noch weniger als weiber sind Lenz ges. schr. (1828) 1, 59;
- Werk[GDJW]1⦅単数で⦆仕事,
作業,労働,活動:behutsam 〈geschickt〉 zu ∼e gehen ⦅雅⦆用心深く〈巧みに〉ことを進める‖
[GRIMM]
B. der besondere bezug auf ein einzelnes faktum.
1) auf eine bestimmte einzelhandlung.
b) besonders geläufige wendungen; ans (ins) werk, zu(m) werke gehen, schreiten, sich ans werk machen:
- Widerlegung[GDJW]
否定,反駁,論破,論駁:
- Widerstreit[GDJW]⦅ふつう単数で⦆抗争,
葛藤;衝突,矛盾:
- Wild鳥獣[GDJW]1 a)⦅集合的に⦆狩猟鳥獣,猟獣,猟鳥:
- Willensakt[GDJW]自分の意志に基づく行為,意志行為:
- Wirksamkeit[GDJW]1
有効〈実効〉性,効果,ききめ,効能:
- Wirkung[GDJW]1
作用,働き,影響力;(原因・作用によって生じる)結果,成果,影響,効果;ききめ,効力;(人に与える)印象,感銘:
- Wohl幸せ[GDJW]しあわせ;
福祉;健康;繁栄:
[GRIMM] wi(e)derfahren
wohl, gemeingermanisches adv. zu gut, dann auch interjektion und konjunktion.
eine konkurrenz erhält das vollwort wohl (bene) durch das seit dem 13. jh. aufkommende adv. gut (s. o. gut, adj., teil 4, 1, 6, sp. 1227ff.), differenziert sich zum teil in der bedeutung von adv. gut oder gibt an dieses einzelne anwendungsgebiete ab, behält aber bis in die gegenwart nicht nur als beteuerungspartikel, sondern auch als vollwort breite verwendung. verstärkt wird wohl als vollwort mhd. und älternhd. durch genug, vast, vil, in älterer und neuerer sprache durch ganz, gar, herzlich, mächtig, recht, sehr, trefflich, überaus, ungemein, unvergleichlich, vorzüglich, und durch adverbiale ausdrücke wie aus den bünden, aus der maszen, über alle maszen, von herzen u. ähnl., von denen mächtig, trefflich als steigerung bei wohl im 19. jh. ungebräuchlich werden.
I. wohl als vollwort.
A. bei finiten verben. in der bedeutung 'zweckmäszig, richtig', woraus sich weiter 'sorgfältig, genau, gehörig', dann 'günstig, erfolgreich, glücklich, gesund', ferner 'angenehm, gefällig, schön' und 'reichlich, ausreichend' entwickelt.
6) aus der bedeutung 'richtig, gehörig, geziemend' entwickelt sich die von 'freundlich, gastlich' in einer reihe von verbindungen, z. b. jem. wohl aufnehmen, empfangen u. ä.
g) einem wohl wollen zugetan, geneigt, freundschaftlich gesinnt, gewogen sein.
(☞wohlwollen)
- Würde[GDJW]1⦅ふつう単数で⦆(態度・言動などに備わる)威厳,品位,気品,品格;(精神・人格などの)高潔さ,気高さ;(人間やその行為の)尊さ,尊厳:
- Wurzel[GDJW]1(英: root)(植物の)根,
《比⦆根底,根本;根源,原因:
-
- Zärtlichkeit優しい愛撫[GDJW]1⦅単数で⦆(zärtlich なこと.例えば:)優しさ,
情の細やかさ:
- Zeichen[GDJW]3
象徴,シンボル;記号;句読点:
- Zeit[GDJW]I 2(Epoche)(歴史の流れの中の)一時期,時代:seituralten ∼en 大昔から(→3 a, 5 a)|3(Zeitraum)a)(ある長さの漠然とした)時間〔の経過〕;期間:seit ewigen ∼en もうずいぶん前から(→2, 5 a)5 (Zeitpunkt)a)(時点としての)時間,時機,好機:Ihre ~ ist gekommen. 彼女の分娩の時が近づいた;彼女の臨終の時が迫った|seit dieser ∼ この時以降(→2, 3 a)|von ∼ zu ∼ときどき,ときおり|9〘聖〙この世,現世,仮の世
[GRIMM]
- zeitabschnitt, zeitraum.
- ein zeitraum, dessen grenzen nicht genau bestimmbar sind oder unbestimmt bleiben;
:
- ) christlich-theologische auffassung stellt die zeit in gegensatz zur ewigkeit; dieser begriff der zeit umschlieszt sowohl die dauer der welt von ihrer schöpfung bis zu ihrem untergang wie den zeitraum vom leben des einzelnen menschen bis zum jüngsten tage;
[GDJW] neuI 3 (die Geschichte der neueren Zeit)近世・近代史;(in neuer Zeit) 近世〔に〕; 最近〔に〕.
5(Zeitpunkt)a)(時点としての)時間,時機,好機:zu jeder ∼いつでも|
- Zeitlang1[GDJW]しばらくの間:
- [Zeit]periode[GDJW]1 a) (Zeitschnitt)
時期,期間,時代.
- Zersrümmerung[GDJW](zertrümmern する・されること.たとえば)粉砕,
破壊;崩壊,瓦解,滅亡.
- Zeuge証憑[GDJW]
居合わせた人;(Augenzeuge)目撃者;立会人;〘法〙証人;〘キリスト教〙証人(あかしびと);⦅比⦆証(あかし),しるし:[GRIMM]älter zeug, m., zeuge, testis.
I. zeugnisverfahren, zeugnisbeweis; weicht als form vor zeugnis zurück und räumt einen theil seines geltungsbereiches dem persönlichen ausdruck ein, s. II 2 a und vgl. jüngeres zeugenschaft für mhd. ziugschaft.
II. zeuge
1) collectiv gesamtheit der zeugen, eine unmittelbar aus der urbedeutung flieszende anwendung, wofür gezeug- belege th. 4, 1, 4, 7013f. gegeben sind und sich fälle von zeug ob. in der einl. finden; eine jüngere eigene collectivbildung gezeug, n., hat kaum boden besessen, s. th. 4, 1, 4, 7012; dat tüch ob. einl.
- Zeugniß[GDJW]2 ⦅雅⦆
証拠になるもの,しるし,証,例証:
- Zorn[GDJW]怒り,
立腹,憤激:
- Zucht[GDJW]1 ⦅単数で⦆(厳しい)しつけ;
規律,秩序.
- Zuchthaus[GDJW]1(懲役刑などの受刑者のための)監獄,
刑務所:
- Zuflucht[GDJW]3逃げ道,逃げる方策〈手段〉:〔seine〕 ∼ zu et.3 nehmen …を頼りとする,…を手段として難を避ける,…に逃避する|
- Zumuthung(できない)注文[GDJW]
(不当な)要求,(無理な)期待.
- Zurechnungsfähigkeit〘法〙帰責能力,
責任能力:
- Zurüsetzung[GDJW](〔sich〕 zurückseten すること.例えば:)冷遇,差別待遇〔されること〕:
- Zusammenhang[GDJW](個々の部分の間の)つながり,脈絡,
意味連関;(相互の)関係,関連,連関:
- Zustand[GDJW]1 a) 状態,
ありさま,様子;(病人などの)容体:
[GRIMM]
die bedeutung von z. hat sich von der sachlichen des äuszeren status oder standes der dinge, den man beobachten und feststellen kann, zu der einheitlichen alles dessen entwickelt, was das dasein des menschen für sein gefühl bestimmt. die immer weiter vordringende ausbreitung des wortes hängt mit dem bestreben zusammen, die menge der vielfachen vorgänge begrifflich sich zum gegenstand zu machen, ist also ein zeichen veränderter sprachlicher anschauung.
3) je mehr das wort ein rein gedachtes geworden, um so freier steht es den einzelnen beziehungen gegenüber, die es von stand her geerbt hat. es bezeichnet fortan von personen und dingen die art ihres seins im gegensatz zu den zuständen anderer oder zu anderen eigenen zuständen. man bemühlt sich seinen begriff zu bestimmen und zu unterscheiden Eisler wb. d. philos. 3, 675:
7) in der naturwissenschaft spricht man von zustandsbeschaffenheit, -änderung, veränderung, -gleichung, -weise, bei der darstellung durch das wort von zustandsbildern, -anschauungen, -schilderungen, -opern und -gedichten, in der sprache unterscheidet man die zustandswörter.
地位(☞Rang, Stellung, Weise)
- Zuteilung[GDJW]1 (zuteilenすること.例えば:)
分配,配当;配分,割り当て,割りふり;配給;配属,配置:
- Zutrauen[GDJW]⦅zu jm.⦆(…に対する)信頼:
- Zuwachs[GDJW]⦅ふつう単数で⦆成長,増大,増加,アップ:
- Zweifel[GDJW](英:doubt)(あり得ないのではないかという)疑い,疑念,疑惑;不信の念,
懐疑;逡巡(→Verdacht):
[GRIMM]
A. zweifel als gemütszustand, in dem der mensch keine eindeutige entscheidung treffen kann, die für sein urteilen, glauben, handeln, erwarten u. s. w. bestimmend wirkt, sondern zwischen zwei entgegengesetzten haltungen wechselt, weil die zu entscheidende sache kein sicheres urteil über ihre möglichkeit, zweckmäszigkeit oder wahrheit an die hand gibt, oder weil der mensch die fähigkeit zum entschlusz nicht aufbringt.
1) zweifel als unentschiedenheit bei der bildung eines urteils, wenn gründe für und gegen zwei oder mehrere mögliche urteile sprechen.
a) unsicherheit in der entscheidung über eine frage, die positiv oder negativ beantwortet werden kann:
b) unklarheit über die beurteilung einer frage, die sich nach lage der dinge nicht entscheiden läszt:
c) schwierigkeit oder unmöglichkeit der einwandfreien bestimmung eines tatbestandes, besonders bei gerichtlichen entscheidungen:
2) zweifel als unsicherheit im glauben, wenn das vorbehaltlose, unbedingte vertrauen auf gott und sein wort kleinmut und unglauben platz macht und beide haltungen abwechselnd vorherrschen; sofern sich eine rein verstandesmäszige, kritische einstellung zu allen fragen des religiösen lebens bildet, nähert sich die bedeutung zweifel B:
4) unentschlossenheit gegenüber zwei möglichkeiten des handelns:
B. zweifel bezeichnet ein eindeutig bestimmtes seelisches oder geistiges verhalten. das wort hat sich bereits im mhd. nach der negativen seite hin entwickelt; erst in der jüngsten bedeutung im philosophisch-wissenschaftlichen bezirk bekommt zweifel auch positiven sinn (s. u. 4).
3) ungläubigkeit gegenüber aussagen, ereignissen und tatsachen, deren wahrheit, berechtigung, existenz, richtigkeit nicht als sicher angesprochen werden kann, da die beweise oder gründe nicht überzeugend scheinen.
a) bei behauptungen:
c) philosophisch im hinblick auf die sinnlich wahrnehmbare welt: der in diese geheimnisse eingeweihte gelangt nicht nur zum zweifel an dem seyn der sinnlichen dinge, sondern ... Hegel w. (1832) 2, 82;
4) zweifel in wissenschaft und philosophie als einwand gegen geltende erkenntnisse und systeme, der meist zu neuer wissenschaftlicher betrachtung führt und so die forschung weitertreibt; seit dem 18. jh. gebräuchlich:
D. besondere wendungen und formelhafte verbindungen.
1) negative ausdrücke mit zweifel für betonte versicherungen der gewiszheit.
a) in älterer sprache, in der formel ist nicht zweifel, in der auch adjektivischer gebrauch in frage kommt: non est dubium nist zuuiual
2) die präpositionen, die die ergänzungen an zweifel anknüpfen, sind
3) formelhafte verbale ausdrücke (in negativer wendung vgl. bereits die belege unter D 1 a)
- Zweiheit[GDJW]二重性,
二元性:
- Zweydeutigkeit[GDJW]両義性,
あいまいさ;(表現などの)きわどさ,品の悪さ:
 ).[afr. coquard „eitel“ — fr. (nonnet à la) cocarde „(Mütze mit) Bandschleife"; ⋄kokett]
[WikiM-C]
).[afr. coquard „eitel“ — fr. (nonnet à la) cocarde „(Mütze mit) Bandschleife"; ⋄kokett]
[WikiM-C]