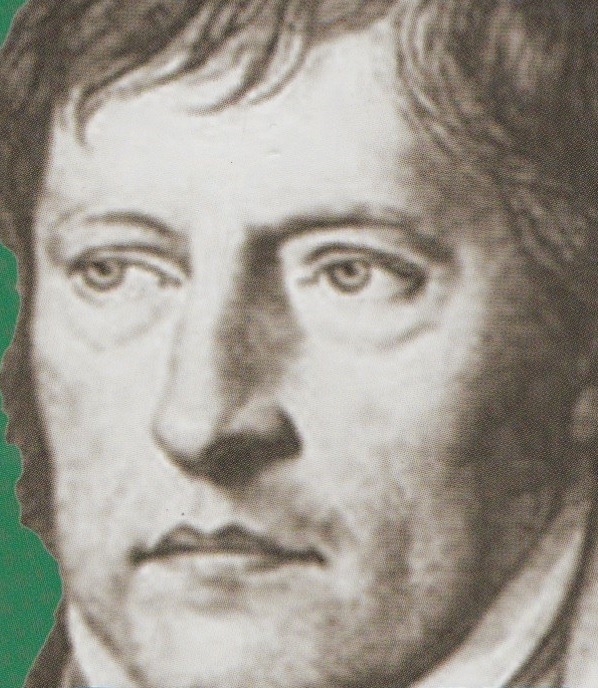A
- abbrechen断絶する[GDJW]I 3(関係を)断つ,(仕事・談話・交渉などを)突然中止する,(作業・操作などを)中断する,打ち切る:(ex.) dem Umgang 〈den Verkehr〉 mit jm. ∼ …との交際を断つ,…と絶交する||
- abhalten[GDJW]I 1⦅jn. von et.3⦆(…の…を)妨げる:
- abhandeln[GDJW]1論じる,(学問的に)取り扱う;討議〈談合〉する;申し合わせる:
- abhangen[GDJW]I 1⦅von jm. 〈et.3〉⦆(…に)よる,左右される,
依存する: - ablegen捨て去る[GDJW]I 2(悪習などを)やめる,捨てる,脱する:
- ableiten導出する[GDJW]2⦅et.4 aus 〈von〉 et.3⦆(…を…から)導き出す;(…から…の結果を)引き出す,(…から…を)推論〈演繹〉する;
〘理・医〙(…から…を)誘導する;〘言〙(ある語から別の語を)派生させる: - ablösen[GDJW]1⦅et.4 〔von et.3〕⦆(付着物を〔…から〕はがす,はぎ取る:再帰 sich4 〔von et.3〕∼ (…から)はがれる,剥離する,はげ落ちる|
- abnehmen[GDJW]II 1減少する;
軽く(短く・細く)なる;弱まる,低下する;(物価が)低落する: - abrechnen[GDJW]I 1⦅et.4 〔von et.3〕⦆(…を〔…から〕)差し引く,引き去る,控除する;〖過去分詞で〗et.4 abgerechnet …を差し引いて;〘比〙…を別として;(☞wegrechnen)
- abreiben[GDJW]I 4こすって〈使い古して〉すり切らす:再帰sich4 ~ すり切れる.
- abscheiden[GDJW]I分離する,
隔離する;〘化〙分離〈析出〉する;〘生〙排出〈分泌・排泄〉する;〘数〙消去する;〘金属〙精錬する: - abschrecken[GDJW]I 1⦅jn.⦆
ひるませる,威嚇する;(武力で)阻止する: - abschröcken[2DWB] ☞ abschrecken.
- absondern分離抽出する[GDJW]1
分け隔てる,隔離〈疎隔〉する;〘法〙(破産法で)別除する;〘化〙分離させる;〘地〙裂開させる;〘哲学〙抽象する:(☞Absonderung) - absorbieren[GDJW]1
吸い込む,吸い上げる,吸収する;⦅比⦆吸収〈同化〉する;合併〈併合〉する: - absprechen[GDJW]I 2(↔zusprechen)⦅jm. et.4⦆(審査・裁定などによって…の…を)否認する:II⦅über jn. 〈et.4〉⦆(…について)否定的な見解を述べる,
(…を)非難する: - absteigen[GDJW]I 1 c)下降する:
- abstoßen[GDJW]I 1 a)突いて離す:(ex.) ein Boot 〔vom Ufer〕~ (オールで)ボートを岸から突き離す.(ex.) sich4 mit den Füßen vom Boden ~ 地をけって飛び出す〈上がる〉,スタートする.[GDJW]I1b)突きのける,払いのける;
⦅比⦆(さっさと)売り払う,たたき売る;(負債を)支払う、さっさと返す:(ex.) die Ecken 〈die Kanten〉 von et.3 ~ …の角を破損する|(☞zurückstoßen ) - abstreifen[GDJW]2 b)(abstreichen)⦅方⦆⦅et.4⦆(…の)よごれをぬぐい〈削り〉落とす:
[GRIMM]
abstreifen, destringere, detrahere: blätter vom baume, vom ast abstreifen, den ast abstreifen; streifet dem baum das laub ab. Daniel 4, 11;
- abstumfen[GDJW]I 1
(とがった鋭利な部分を)摩滅させる,鈍くする;(感覚・感情などを)鈍磨させる. - abtrennen[GDJW]1(付着しているものを)
切り離す,切断する: - abtun[GDJW]2 a)(erledigen)(手早く・あっさりと・軽蔑的に)片付ける,
処理する: - abwälzen擦りつける[GDJW]1 b)⦅et.4〔von sich3 auf jn.〕⦆(負担などを)押しつける,肩代わりさせる:die Arbeit 〈die Verantwortung〉 auf einen anderen ∼ 他人に仕事を押しつける(責任を転嫁する)
- abweckseln[GDJW]I⦅mit jm. 〈et.3〉⦆(…と)交代する,
代わる: - abweichen[GDJW]1⦅von et.3⦆(方向が…から)それる,外れる;⦅比⦆(…から)逸脱する:
- abweisen[GDJW]I 1⦅et.4⦆退ける,はねつける,
拒否する:〘法〙(申し立てを)却下する: - achten[GDJW]I 1(↔verachten)尊敬する,尊重する:
- ahnen[GDJW]I予感する,
予覚する;うすうす感づく,ほのかにそれとわかる:(☞Ahnung) - andeuten[GDJW]I 1⦅〔jm. 〕 et.4⦆
暗示する,示唆する,ほのめかす,それとなく知らせる;⦅et.4⦆大づかみに〈おおまかに・概略だけを)示す;(…の到来を)予示する,(…の)徴候を示す: - aneignenわがものにする[GDJW]1再帰sich3 et.4 ~ …を不当にわがものにする,
着服〈横領〉する;〘法〙…を先占する:2再帰sich3 et.4 ∼ …(知識・習慣・態度など)を身につける: - anführen[GDJW]2
申し立てる,持ちだす;引き合いに出す,引用する:(ex.) et.4 als Grund 〈zum Beweis〉~ 「を理由〈証拠〉に挙げる」。 - anfangen[GDJW]II自:1(↔enden, aufhören)(時間的・空間的に)始まる,開始される2 a)⦅mit et.3⦆(…を)始める,(…に)とりかかる,着手する:
[duden]
Bedeutungen / 1.a) etwas in Angriff nehmen, mit etwas beginnen
Antonyme zu anfangen / beenden
Herkunft / mittelhochdeutsch an[e]vāhen, althochdeutsch anafāhan, ursprünglich = anfassen, in die Hand nehmen
von et.3 anfangen…について議論しはじめる [GDJW]II 2 c)…について話し始める,…の話題を切り出す: - angeben跡づける[GRIMM]
indicare, designare, prodere, anmelden, anstimmen:
(☞Angabe ) - angehen[GDJW]II 3(s)(betreffen)⦅jn. / et.4⦆⦅ふつう3人称現在・過去の形で⦆
関係する,かかわる: - angehören[GDJW]2⦅雅⦆⦅jm.⦆(…と)
親しい関係にある,密接に結ばれている:(☞angehörig) - angreifen[GDJW]I 1攻めかかる,攻撃する,
襲う;激しく非難〈論難〉する:(☞berühren ) - anhalten, jn. zu et.3[GDJW]3(…を…へと)促す,励ます,(…に…を)勧める、(…を…するように)仕向ける:
- anheimfallen供される[GDJW]⦅雅⦆⦅et.3⦆
(…の)ものとなる,(…の)手に帰する:[DUDEN]1.als Eigentum zufallen
2.einer Sache zum Opfer fallen
- ankommen[GDJW]I 1 a)⦅(方向ではなく)場所を示す語句と⦆(…に)着く,到着する:b)
近づいて〈迫って〉来る:4⦅auf et.4 〈jn.〉⦆(…に)かかっている,(…)しだいである:(ex)~によりけり。Es kommt auf et.4 an. …が問題〈重要〉だ。:
[GRIMM]2) gleich intransitiv ist weiter die häufige unpersönliche redensart: es kommt darauf an, es läuft darauf hinaus, in eo vertitur;
結局…が問題〈重要〉だ。(☞hinauslaufen) - anknüpfen[GDJW]I 1
結んでつなげる,結びつける: - anlangenたどり着く[GDJW]I⦅雅⦆(ankommen)⦅場所を示す語句と⦆(…に)着く,到着する:
- annehmen[GDJW]4
(vermuten)(…と)推量する,思う;(voraussetzen)(…と)仮定する,想定する,見なす: Cf. nehmen - ansagen[GDJW]I 1 a)
告げる,通知〈通告〉する;予告する;アナウンスする;〘トランプ〙(切り札などを)宣言する,ビッドする:[GRIMM]sein vermögen ansagen, angeben, zur besteuerung.
- anschließen[GDJW]I 2 a)⦅et.4 et.3 〈an et.4 / an et.3⦆(…を…に)接続する,連結する;(…を…に)付け加える:
- ansehen[GDJW]3 b)(halten)⦅et.4 für 〈als〉 et.4⦆(…を…と)見なす,
(…を…だと)考える:5⦅jm. et.4⦆(…の外見から…を)見てとる,看取する(…が…であることが)見てわかる: - anstellen[GDJW]4⦅et.4⦆a)⦅機能動詞として動作名詞と⦆(…を)する,行う:(ex.)mit jm. Verhör ~ …に対して尋問を行う.
- anstrengen[GDJW]I 1(能力などを)大いに働かせる,
極度に緊張させる: - antreffen目のあたりにする[GDJW]⦅jn.⦆(…と)出会う;(vorfinden)⦅様態を示す語句と⦆(…の状態にある…を)見いだす:(☞vorfinden)
- antun[GDJW]1⦅jm. et.4⦆
(…に好意・敬意などを)示す,表する;(…に危害・苦痛などを)加える,与える:jm. Gutes 〈eine Wohltat〉 ∼ …に親切にする〈善行を施す〉| - anziehen[GDJW]2 a)⦅et.4⦆(自分のほうへ)引き寄せる,
(手元に)引きつける: - aufbewahren[GDJW]保存する,
保管する: - aufdecken[GDJW]2 b)(弱点・欠陥・秘密・真相などを)
さらけだす,暴く,暴露する: - aufdrängenおのずと胸に迫る[GDJW]2sich4〔jm.〕~(想念・疑惑などが)
おのずと〔…の〕胸にわいてくる: - aufdrücken刻印する[GDJW]I 1 a)⦅et4 auf et4⦆(…を…の上に)
押し付ける,押し当てる;⦅et3 et4⦆(…に印・スタンプなどを)押す,捺印する: - auffassen受け取って理解する[GRIMM]
mit bedacht aufnehmen und ergreifen
:[GDJW]2把握する,理解する: Cf. fassen - aufführen[GDJW]3(名前・事実・項目・例などを)挙げる,
引き合いに出す;(リストなどに)記載する: - aufgeben[GDJW]3 a)⦅et.4⦆(これまで続けてきたことを途中で)
やめる,放棄する,断念する;(これまで保持してきたものを)手離す: - aufhalten引き留める[GDJW]I 1⦅jn.. / et.4⦆
引き止める;(進行を)阻む,阻止する,押しとどめる: - aufhören[GDJW]I 1とぎれる,とだえる,やむ;(↔anfangen)〔活動を〕
停止する,やめる: - auflegen[GDJW]I 3(aufbürden)⦅jm. et.4⦆(…に税・重荷・罰などを)課する,
負わせる: - auflösen[GDJW]I 2 b)⦅比⦆(取り決めたこと・存立しているものなどを)解消
(解散)する,やめる,取り除く;〘楽〙(不協和音を)解決する;(調号を本位記号♮によって)取り消す,幹音に戻す: - aufnehmen受け入れる[GDJW]I 1(下にある・横たわっている・落ちているものを)取り〈拾い〉上げる,手に取る,
(子供・猫などを)抱き上げる〈起こす〉,(トランクなどを)持ち上げる;(持ち上げて)になう;(取り上げて)除く;(垂れているものを)たくし上げる,からげる;(中にあるものを)取り〈掘り〉出す:
2(外部にあるものを中に)受け〈取り〉入れる,収容する,迎え〔入れ〕る,歓迎する,加入させる,加える,参加(入会・入党)させる:掲載する;受容〈摂取〉する;,(心の中に)受け取る,解する; - aufschließen[GDJW]I 2⦅jm. et.4⦆(…に…を)明らかにする,
解明する,解説する: - aufsteigen[GDJW]I 1 c)上昇する,立ちのぼる;
(鳥・飛行機などが)飛び立つ: - aufstellen[GDJW]I 4 b)(法則・学説などを)立てる:
- aufsuchen[GDJW]3(本などをめくって)探し出す:
- auftreten[GDJW]I 1 a)(俳優が舞台に)登場する,
出演する:[GDJW]I1b)現れる,出現する,発生する:(☞treten) - auftun[GDJW]1再帰sich4 ~
あく,開く;現れる,急に開ける(見えてくる)| - aufzählen[GDJW]1 b数え上げる,列挙する:
- aufzeigen[GDJW]I(はっきり)示す、明示する;指摘する;説明〈証明〉する:
- ausbessern[GDJW]修繕〈改装〉する;修正する:[DUDEN]
emendare, corrigere, verbessern:
- ausbilden[GDJW]2⦅et.4⦆十分に発達させる:再帰sich4 ~ 発達する,
成立する;(花が)開花する: - ausdehnen[GDJW]I 1(空間的・時間的に)延長する,(空間的に)拡張〈拡大〉する:
- ausdrücken表現する[GDJW]3(気持などを)表明する,
述べる,示す: - auseinanderfallenばらばらになる[GDJW]2 a)ばらばらに崩れる,
崩壊する:[GRIMM] auseinanderAUSEINANDER, wie aneinander, aufeinander und alle ähnlichen zu beurtheilen, das lebendige ein aus dem andern verhärtete sich allmälich, mit vorangerückter praeposition, zu einer unbeweglichen masse. jedwedes verbum, mit dem sich die vorstellung des zerlegens und trennens verknüpft, kann ein solches aus einander bei sich haben und man hat sich daran gewöhnt, es fester anzuheften, woraus eine menge der schwerfälligsten zusammensetzungen entspringen: auseinanderlegen, auseinanderfallen, auseinanderflieszen u. s. w. es ist natürlicher, das auseinander abgetrennt zu schreiben, doch bei substantivbildung bleibt der anschlusz unvermeidlich: auseinanderlegung, auseinandersetzung, auseinanderblätterung;
- auseinandergehen[GDJW]別れる,
解散〈発散〉する,(マヨネーズなどが)分離する;(金属・編物などが)のびる;⦅話⦆太る: - auseinanderhaltenばらばらにしておく[GDJW]
区別する:(ex.) Ich kann die Zwilinge nicht ~. 私にはこの双生児の見分けがつかない.[GRIMM] haltenII. Besonders häufig hat sich halten in transitiver fügung und in der mehr oder weniger scharf hervortretenden bedeutung fest halten, längere zeit führen oder haben, entwickelt. es ist bereits unter haben (sp. 50) darauf aufmerksam gemacht, dasz wie oft beide wörter halten und haben sich begrifflich berühren und eins für das andere steht, ihre verwandtschaft auch äuszerlich durch eine enge allitterierende verbindung hervorgehoben wird:
5) gegen einander gehalten werden dinge bei vergleichungen oder abwägungen, um ihre eigenschaften zu beurtheilen:
Dagegen aus einander hält man dinge die in keine gegenseitige beziehung treten sollen.
- auseinandersetzenたがいに離れあう
[GDJW]
(理由・事態・計画などを)説明〈分析〉する: [DUDEN]4.voneinander wegsetzen
(☞ auseinanderfallen) [GRIMM] auseinanderDie geläufigsten verknüpfungen des auseinander erfolgen mit bringen, fahren, fallen, gehen, legen, rücken, setzen, sprengen, stellen, treiben, ziehen:
sie fanden das jahr darauf für gut, sich durch das losz aus einander zu setzen. Lessing 5, 106; Cronegk aber hatte Clorinden verliebt gemacht, da war es freilich schwer zu errathen, wie er zwei nebenbuhlerinnen aus einander setzen wollen, ohne den tod zu hülfe zu rufen. 7, 11;
- auseinandertreten[DUDEN]
1. durch Darauftreten zerstören, in Stücke gehen lassen
- ausfallen[GDJW]I 1(歯・髪・字句などが)抜け〔落ち〕る;
〘言〙(語中音が)消失する;〘理〙沈殿する,(放射能灰などが)降下する.: - ausführen現に成し遂げる[GDJW]2 a)(計画・決定などを)
実行(遂行)する;〘劇〙演じる;〘楽〙演奏する:2b)(手を加えて)作り上げる,仕上げる,制作する:3:(考えなどを)〔詳しく〕述べる,詳説(説明)する: - ausgehen[GDJW]3⦅von et.3⦆(…を)出発点とする:4⦅von jm.3 (et.3)⦆
a)(考えなどが…から)出る,出される,(…に)由来する:b)(匂い・光・魅力などが…から)発散する;(道などが…から)出ている,放射している: - ausgreifen[GDJW]II 1つかみ
〈探り〉出す. - aushalten持ちこたえる[GDJW]I 1 a)(積極的に)耐え抜く,こらえる,辛抱する:
- auslaufen[GDJW]I 2流れ〈あふれ〉出る;漏れ〈こぼれ〉出る;(leerlaufen)(容器が)漏って空になる;(染料・インクなどが)にじむ;〘印〙(原稿などが)予定量をはみ出る,収まりきらない.
- auslegen露出する[GDJW]I 1 a)(ausbreiten)
広げる、並べて置く;(商品を)陳列する;(名簿を)公開する、供覧する:2(ひそんでいる意味を引き出して)説明する,解釈する:告知する [GRIMM]exponere, pandere, étaler, nnl. uitleggen.
1) den kram, die waare auslegen, feil bieten, zur schau legen
6) auslegen, proponere, vorlegen, darlegen, vorschlagen:
9) auslegen als gegensatz des anlegens, exuere:
(☞Auslegung) - ausmachen[GDJW]2 a)
完成〈成就〉する:3 a)形成している,(…の)特徴(本質)をなす:c)⦅受動態なし⦆⦅viel, etwas, nichts などと⦆意味(重要性)をもつ,相違〈支障〉がある:5⦅et.4〔aus et.3〕⦆取り出す〈除く〉: [GRIMM]um sich die bedeutungen klar zu denken, erinnere man sich des lat. facere, efficere, conficere, perficere; vielfach berührten sich abmachen und abthun, aufmachen und aufthun, wenig schon anmachen und anthun, noch weniger ausmachen und austhun. alles läszt sich zurückführen auf die hauptvorstellungen aus, zu ende, fertig und aus, heraus, hinaus.
8) abstract genommen, ausmachen, ausfinden, herausbringen, auftreiben, zu wege bringen:
nichts ausmachen ナンセンスである - ausrotten根絶やしにする[GDJW]根絶する,絶滅させる;∇(木などを)根こぎにする:
- ausscheiden[GDJW]II 2脱退(引退・退会・退職)する:
〘スポーツ〙予選などで敗退〈失格〉する: - ausschließen[GDJW]2⦅et.4⦆
不可能にする,排除する:[DUDEN]3.a) nicht teilhaben lassen
排他的 ausschließend[DUDEN] - äußern表現する、表示する[GDJW]2(気持ちなどを行動で)表す、示す:再帰sich4 ∼⦅様態を示す語句と⦆(…の形で)示される、現れる|(☞Äußerung)
- aussehen[GDJW]I 1⦅様態を示す語句と⦆(…の)外観を呈する,
(…のように)見える,(…の)印象を与える;(…のような)顔をしている;,(…の)様子である,…しそうである: - aussprechen言明する[GDJW]2 a)(だまっていないで)
口に出している,(気持などを)言い〈書き〉表す,述べる;表現する: - ausströmen[GDJW]I自(↔einströmen)(水・ガスなどが)流れ
〈漏れ〉出る;(群衆などが)流れるように出てくる;⦅雅⦆(ausstrahlen)放散〈発散〉される: - ausüben[GDJW]1
(行為を)行う;(職業を)営む;(職務を)果す,執行する:2 a)(権利を)行使する:b)(影響などを)及ぼす;(権力などを)振るう: - auszeichnen[GDJW]I 1 a)際立たせる,目立たせる:
B top
- bauen建てる[GDJW]I 1
建設〈建築〉する,建造〈製造〉する: - beabsichtien[GDJW]意図する,もくろむ,(…する)つもりである:
- bedeuten[GDJW]I 1 a)(語句・記号・象徴などが)意味する,
表す;(…という)意味である: - bedingen[GDJW]I 1⦅規則変化⦆a)(verursachen)結果として生み出す,引き起こす:b)(voraussetzen)前提とする:
[GRIMM]
bedingen, pacisci, conditionibus circumscribere, was ahd. bloszes dingôn oder gidingôn ausdrückte, auch mhd. erscheint bedingen nur sparsam (Ben. 1, 339a). ding aber hatte ursprünglich die bedeutung von causa, handel, woraus sich erst später die von res, wie aus causa die des franz. chose entfaltete. wenn daher Schelling (philos. schr. 1, 7) unser bedingen ein vortrefliches wort nennend es erklärt als die handlung, wodurch etwas zum ding werde, bedingt, das was zum ding gemacht sei, unbedingt, das was gar nicht zum ding gemacht sei, gar nicht zum ding gemacht werden könne; so scheint dieser sprachgebrauch nicht aus der geschichte des wortes selbst zu folgen. bedingt sein hiesz auf einen gepflogenen handel zurückgehn, dadurch bestimmt werden; nachher verband man auch damit die vorstellung des seinen grund in etwas tragens, des hypothetischen, mit unbedingt des absoluten.
1) bedingen, aushalten, bestimmen, ausnehmen:
2) sich (se) bedingen:
みずからを条件とする。ものになる3) sich (sibi) bedingen, verbinden, aushalten:
- bedürfen[GDJW](brauchen)⦅js. / et.2⦆(…を)必要とする:
- beengen[GDJW]狭める,
窮屈にする;圧迫する;制約〈拘束〉する - befassen包括する[GDJW](beschäftigen)2再帰sich4 mit et.3 ∼…に従事する;…と取り組む,
…にかかわり合う:[GRIMM]amplecti, complecti, begreifen, befangen, nnl. bevatten:
- befestigen釘付けする[GDJW]1固定する:2
固める;堅固にする,強化する;(…の)防備を固める:(☞fixieren) - befinden感じがする[GDJW]2⦅雅⦆sich4 ∼ ⦅様態を示す語句と⦆(…の状態に)ある;
(…の)健康状態である:[GRIMM]invenire, deprehendere, nachdrücklicher, doch abstracter als finden, zuweilen empfinden, fühlen.
6) sich befinden, franz. se trouver
- befriedigen[GDJW]I 1 a)⦅jn. / et.4⦆(…の欲求・期待などを)満たす,満足させる,
充足させる: - befügen[GDJW]I⦅jn. zu et.3⦆(…に…の)権限
〈資格〉を与える. - begeisten精神を吹き込む[GRIMM]
inspirare, divino spiritu afflare:
- begnügen甘んじる[GDJW]再帰sich4 mit et.3 ∼ …で満足する〈十分である〉|sich4 mit seinem Los〔e〕 ∼ 自分の運命に甘んじる.
- begreifen概念に含む[GDJW]2(einbegreifen)(中に)含む,包含する:et.4 in sich3 ~ …をそれ自身の中に包含している:
- begrenzen, begränzen限界づける[GDJW]1限る,(…の境をなす):
[GRIMM]
begränzen, s. begrenzen.
- begründen[GDJW]I 1基礎づける,
地固めする;(理論などを)築く;(団体などを)創設する:2理由〈根拠〉づける,(理由をあげて)説明する:〘法〙立証する - behalten[GDJW]1
(手離さずに)持ち続ける,保持する:(ex.) ein Geheimnis für sich4 ∼ 秘密を守る〈もらさない〉|den Gewinn für sich4 ∼ 利益を独占する|Dein Geschenk kannst du für dich ∼. この贈り物は〔せっかくだが〕いらないよ|2(動かさずに)とどめておく:3 a)(衰えないように)保つ,維持する:保存する - behandeln[GDJW]2(テーマなどを)扱う,論じる;題材としている:
- beharren恒存する[GDJW]1⦅auf et.3 / bei et.3⦆
(…を)あくまでも固持する;しつこく主張する,⦅in et.3⦆(ある状態を)固く持ち続ける: [GRIMM]permanere, perseverare, verbleiben, verharren, ausdauern.
- beibehalten[GDJW]1(習慣・伝統などを)維持〈保持〉する;(テンポを)持続する;(艦船を)保有する;(計画を)続ける,固執する:
- bekleiden[GDJW]1 b⦅雅⦆⦅et.4 mit et.3⦆(…に…を)かぶせる,(…を…で)覆う,被覆する:
- bekommen[GDJW]I⦅haben の完了相にあたり,受動態なし:→haben I⦆2⦅et.4⦆(…が)存在するようになる:a)⦅当人の意志とは関係なく⦆①(ある感情・状態が)生じる,出てくる,わく;(ある状態に)陥る:②(…が)備わる〈存在する〉ようになる:an jm. einen Freund ∼ …という友達ができる‖
- bekümmern[GDJW]I 2再帰sich4 um et.4 ∼ …を気にかける,
心配〈世話〉をする: - belassen[GDJW]1放置する,
そのままにしておく: - beleben[GDJW]I 1(…に)生命を与える;
元気〈活気〉づける;蘇生させる: - beleuchten[GDJW]1照らしだす,
(…に)光をあてる,照明する;明るくする: - bemächtigen[GDJW]1再帰sich4 et.2 ∼ …を
占領する〈わがものとする〉;…を奪取する: - bemerken[GDJW]2 a)
述べる,言い添える;コメントする: - bemessen[GDJW]1
量る,量定する,〈税などを〉査定する: - benehmen[GDJW]2⦅雅⦆⦅ふつう物を主語として⦆a)(entziehen)⦅jm. et.4⦆(心身の機能を)奪う:
[GRIMM]
nehmen drückt dann mehr ein gänzliches entziehen und rauben aus, benehmen ein hemmen, aufhalten, hindern, und in diesem sinn steht auch das licht, die aussicht, die sprache, schmerzen, den athem benehmen, wiewol sich gleichfalls sagen läszt das licht, den athem nehmen, wegnehmen.
1) gewöhnlich mit dat. der person, acc. der sache: das benimmt mir viel, wenig, nichts;
- bekümmern[GDJW]I 1⦅jn.⦆(…の)心を煩わす,
心配させる;悲しませる: - berechnen[GDJW]1再帰⦅sich4⦆算定
〈算出〉される.:(☞Berechnung) - berechtigen正当化する[GDJW]I⦅jn. zu et.3⦆(…に…する)
権利〈権限・資格〉を付与する: - berufen[GDJW]I 2再帰sich4 auf et.4 ∼
…によりどころを求める,…を引き合いに出す,…をたてに取る|3⦅jn.⦆(…〔の言葉〕を)引用する,取りざたする:[DUDEN]4. zu viel [im Voraus] über etwas reden, sodass es (nach abergläubischer Vorstellung) misslingt oder nicht in Erfüllung geht; beschreien (meist verneint)
- beruhen[GDJW]1⦅auf et.4⦆(…に)基づく,
起因(依拠)する: - berühren接触する,弄る[GDJW]1⦅et.4⦆a)(…に)触れる,
さわる;〖数〗接する:再帰 sich4 mit et3 ~ …と接触する(合致する)点がある[GRIMM]tangere, attingere, attrectare, ahd. pihruoran, mhd. berüeren, nnl. beroeren, anrühren, angreifen.
(☞angreifen) - beschaffen[GDJW]⦅述語的⦆⦅様態を示す語句と⦆(…の)性状
〈性質〉をもった: - beschäftigen[GDJW]I 1 sich4 mit et.3 beschäftigen …に従事する〈取り組む〉,
…を仕事とする,…に力〈時間〉をさく: - beschließen[GDJW]
決議〈議決〉する;決定〈決心〉する: - beschränken[GDJW]I 1 制限する,
限定する,局限〈制約〉する: - beschuldigen[GDJW]1 ⦅jm. et.3⦆(…の…を)とがめる,
(…に…の)罪を帰する: - besuchen通って調べる[GDJW]2 ⦅et.4⦆(ある目的で…に)
出かけて行く;見物〈参観〉に行く、参加〈出席〉する:[GRIMM]5) besuchen, scrutari, explorare, tentare, prüfen, abstraction des vorausgehenden.
- bestätigen[GDJW]1 ⦅et.4⦆(…が真実・有効なことを)確認する,
証明〈立証〉する: - bestehen存立し続ける[GDJW]I 1 a)
(現に)ある,存在〈現存〉する;あり続ける,存続する: I 2⦅aus et.4⦆(…から)成る,できて〈構成されて〉いる:
じつのところ…にあるI 3⦅in et.3⦆(実質的に…に)ある,存する:
I 4⦅auf et.3 〈et.4〉⦆固執〈主張〉する,(あくまでも)要求する:
[GRIMM]Unser bestehen entfaltet sowol die intransitive bedeutung des lat. consistere und constare, als die transitive von circumsistere, circumstare. jene pflegt das praet. mit sein, diese mit haben zu umschreiben.
- bestehenbleiben[GDJW]
存続する,(変わらず)続く;(消滅しないで)残る,不滅である:(☞bleiben) - bestrafen[GDJW]⦅jn./et.4⦆処罰する,(…に)刑罰を与える:(☞strafen)
- betätigen[GDJW]3⦅雅⦆
行為に表す,実行に移す: - beten[GDJW]I 祈る,
祈りをささげる: - betrachten[GDJW]1
観察する,考察する:2みなす:(ex.) et.4 als seine Pflicht betrachten …を自分の義務と心得る. - betreffen[GDJW]I 1⦅jn. / et.4⦆(…に)
関係する,かかわる;(…に)該当する: - betriegen[GDJW]
[GRIMM]
betriegen, betrügen, fallere, decipere, inducere,
1) betriegen steht, wie berücken, vom fangen, bestricken des wilds, der vögel, der menschen.
8) sich betriegen, se tromper, sich teuschen:
(☞betrügen) - betrügen[GDJW]だます,欺く,ペテンにかける;(浮気をして配偶者を)裏切る:(☞betriegen)
- beurteilen[GDJW]I 1
判断〈判定〉する;評価する;批判する: - bewahren[GDJW]1(心の中に)とどめる;⦅雅⦆(aufbewahren)保存する:2(ある状態を)保ち続ける,
維持する:3(behütten)防ぐ;守る:jn. ⟨et.4⟩ vor et.3 &sim …を…から守る| - bewähren真(実)だと認める[GDJW]I 1sich4 ∼ 真である〈適する〉ことが実証される,
確証される,認められる,実が現れる,実績があがる;試練に耐える,試験に合格する: - bewegen[GDJW]I 1 a) 動かす;運動〈移動〉させる:再帰sich4 ~ 動く,移動していく〈来る〉|
- beweisen[GDJW]1 a)(…が真実であることの)
証拠を示す,(…を)証明〈立証〉する: - bewenden[GDJW]I⦅もっぱら次の成句で⦆ es bei
et.3 ~ lassen …に甘んじる,…に満足する,…だけにしておく - bewirken[GDJW](結果として)もたらす,
生じさせる: - bewundern[GDJW]
讃嘆〈感嘆〉する,賛美する;尊敬する:(☞Bewunderung) - bezahlen[GDJW]1 a)⦅et.4⦆(…の)代価〈料金〉を払う,(料金などを)支払う;あがなう,償う:2⦅et.4⦆a)(家賃・税金・料金などを)支払う: die Miete ⟨seine Schulden⟩ ∼ 家賃〈借金〉を支払う|
- bezeichnen[GDJW]2示す,指示
(指定)する:4⦅et.4 als et.4⦆(…を…と)呼ぶ,名付ける: - beziehen[GDJW]I 1 a)⦅et.4 〔mit et.3〕⦆(…に〔…を〕)上張りをする,(bespannen)(…にカバーなどを)かぶせる,おおう;(…に弦などを)張る:4⦅et.4 auf et.4⦆
(…を…に)適用する,当てはめる,(…を…に)関連〈関係〉づける:再帰sich4 auf et.4 ∼ …に関連〈関係〉がある - bezwingen[GDJW]
(敵を)屈服させる,征服〈攻略〉する;(困難・障害などに)打ち勝つ,克服する;(感情・欲望・苦痛などを)抑える,抑制する: [GRIMM]circumducere, umziehen, überziehen
15) abstractes sich beziehen, pertinere, referri, referre se ad aliquid, heute unter allen bedeutungen die geläufigste:
- binden[GDJW]I 2 b)⦅jn.⦆縛りあげる;⦅比⦆
拘束〈束縛〉する,義務づける;抑制〈阻止〉する: - bleiben残り続ける[GDJW]I 1(↔gehen)とどまる:I 1 b)(übrigbleiben)⦅jm.⦆残る,
無くならない,余る:(ex.)Vom seinem ganzen Vermögen blieb ihm nur sein Haus. (ex.) Es blieb 〔ihnen〕 nur eine schwache Hoffnung.
(永く)あり続ける、永続する[GDJW]I 2⦅述語名詞・述語形容詞などと⦆いつまでも〈依然として〉(…のまま)である: (☞bestehenbleiben) - bleibend[GDJW]III
永久の,永続的な,不変の,一定の: - blicken[GDJW]1見る,見やる;(…な)目つきをする:〖lassen と〗sich4 ~ lassen 姿を見せる,
現れる;尋ねて来る;(☞hindurchblicken) - brauchen[GDJW]I 1 a)(nötig haben)必要とする:
- brechen割り込む[GDJW]II 3⦅方向を示す語句と⦆b)⦅in et.4⦆(…に)押し入る:
[GRIMM]
Brechen enthält die vorstellung eines trennens, spaltens der ganzheit, heftigen, erschütternden, krachenden berstens und reiszens, zumal wenn es
I. intransitiv, ohne casus gesetzt ist.
22) brechen in etwas, irrumpere:
- bauen建てる[GDJW]I 1
C top
- charakterisieren[GDJW]1 a)特徴
〈特色〉づける,(…の)特徴〈特質〉をなしている:
- charakterisieren[GDJW]1 a)特徴
D top
- dabeiseinつねに離れずにいる[GDJW]1居合わせて〈参加して〉いる:2⦅zu 不定詞〔句〕などと⦆〔ちょうど〕…しているところである:[DUDEN]
1. an etwas teilnehmen, bei etwas mitmachen
2. gerade mit etwas Bestimmtem beschäftigt sein
[GRIMM]2. dieser begriffer weitert sich, wenn dabei auf verhältnisse und zustände geht, es heiszt dann soviel als daran, dazu, damit, zugleich.
dabei sein wird in verschiedenen bedeutungen gebraucht, als wann ich persönlich darbei (zugegen) gewesen wäre Simpliciss. 1, 25. da müste ich auch dabei sein, da hätte ich mitzureden, das kann ohne mich nicht geschehen. dann heiszt es unablässig, unverdrossen arbeiten, wofür man auch daran sein gebraucht.
- darbieten[GDJW]2(anbieten)⦅jm. et.4⦆
差し出す,提供する: - darstellen具現する[GDJW]2⦅et.4⦆
(…で)ある,(…を)意味する,表す,示す;具現する:[GDJW]3a)sich再帰4 als ... ~…として現れる,…になる,…であることが明らかになる: - dartun証かす[GDJW]⦅雅⦆明らかにする,示す、説明する,証明する:
- dauern2[GDJW]2⦅雅⦆長続きする,長持ちする,いつまでも変わらない:(☞fortdauern)
- definieren[GDJW](語や概念などを)定義する;
(本質・内容・性質を)限定(明示)する,厳密に説明〈記述〉する: - deuten[GDJW]I⦅aur jn.〈et.4〉⦆(…を)さし示す,指向する;暗にさす,ほのめかす;(…の)現れ〈前兆〉である:[GRIMM]
zeichen geben, zeigen, anzeigen, hinweisen, bedeuten, erklären, auslegen
1. im eigentlichen sinn ein zeichen geben, mit dem finger, der hand, dem kopf, den füszen u. s. w., gestibus significare.
- dienen[GDJW]2 a)〖しばしば目的語なしで〗〔jm.〕 als et.1 〔zu et.3〕~
〔…に〕…として役に立つ,〔…の〕…に用いられる: - dirimieren分割する[DUDEN]
(bei Stimmengleichheit) eine Entscheidung (zugunsten der einen oder der anderen Partei) treffen
HERKUNFT: lateinisch dirimere = (unter)scheiden
(☞Diremtion) - durchdringen[GDJW]I 1
貫通する,刺し通す,浸透する: - durchgehen一貫する,通覧する[GDJW]I 自1
通り抜ける,通行する;通過〈透過〉する;パス〈合格〉する:2(ある区間を)通り抜ける,一巡する;(全体を)一貫する;(一定期間)休みなく続く: II 他 1 a)(…の全部に)目を通す,見直す,吟味する,点検〈検算〉する:(☞Durchgang) - durchlauchen遍歴する,(時間・空間を)走行する[GDJW]1
走破する;(…を通って)走り抜ける;縦走〈横断〉する;⦅比⦆(課程などを)終了する;(…に)ざっと〈ひととおり〉目を通す: - durchschauen[GDJW](事柄の本質・内情などを)見抜く;
(人の真底を)見破る: - dürfen[GDJW]I⦅話法の助動詞として、他の動詞の不定詞とともに用いられ、その場合過去分詞には不定詞の形が用いられる.文意が明らかな場合には本動詞を省略することがある⦆(h)1 a)⦅許可・資格・十分な根拠などを示して⦆…してもよい,…してかまわない,…することが許されている;…してしかるべきである:∇c)⦅スイスでは今日も用いられる⦆(wagen)あえて…する:
[GRIMM]
4. wagen, sich erdreisten, sich erkühnen, kühn genug sein,
5. es wird auch eine möglichkeit oder wahrscheinlichkeit damit ausgedrückt. es ist dann immer das praet. conj. nötig.
- dabeiseinつねに離れずにいる[GDJW]1居合わせて〈参加して〉いる:2⦅zu 不定詞〔句〕などと⦆〔ちょうど〕…しているところである:[DUDEN]
E top
- eindringen[GDJW]1(抵抗・障害を排して)はいり〈潜り〉込む,侵入〈闖入〉する:⦅比⦆研究する,〔奥義を〕きわめる:
- eindrücken(力を)かける,当てる[GDJW]1⦅et.4 in et.4⦆(…を…の中に)押し込む,(…を…の上に)押し付ける,塗り込む;⦅比⦆刻印する:
- einfallenひらめく[GDJW]1⦅jm.⦆
(…の)念頭に浮かぶ,(…が)思いつく;4(光線が)さし込む,入射する:[GRIMM]5) subire, in den sinn, in die gedanken kommen:
- einfinden[GDJW]1sich4~
姿を現す,到着する,出頭する;⦅比⦆(事態が)訪れる;(物が)見つかる: - einführen[GDJW]1⦅et.4 in et.4⦆(…を…の中に)
差し入れる,差しこむ,,挿入する;(タイプライターに用紙を)巻き入れる;(電線を)引き込む;(収穫物を車で)運び込む: - eingehen[GDJW]I 1(hineingehen)⦅方向を示す語句と.ただしもっぱら比喩的な意味で⦆(…に)入る,入り込む;
- einhüllen包み隠す[GDJW]⦅et.4 in et.4⦆(…を…のなかに)包み込む,
くるむ:再帰 sich4 in et.4 ~ …に身を包む,…に包まれる|[GRIMM]2 ... 2) eingehüllt, verborgen, verdeckt, unentfaltet:
- einlassen[GDJW]3 a)再帰sich4 mit jm. ∼ …と関係〈関わり合い〉をもつ3 b)sich4 auf et4 〈in et4〉~ …と掛かり合う,…に巻き込まれる:
- einleiten[GDJW]2導入する,
(催しなどを)始める: - einleuchten[GDJW]I 1⦅jm.⦆(…にとって)明白である,理解〈納得〉できる:
- einräumen[GDJW]2⦅jm. et.4⦆
明け〈譲り〉渡す;⦅比⦆(特権・事実などを)認める,容認する: - einrichten[GDJW]3
整える,調節する;適合〈順応〉させる,都合をつける,(…となるよう)工夫する: - einschieben書き入れる[GDJW]2
挿入する,割り込ませる:(ex.) ein Wort ~ 一言さしはさむ;(こっそり)書き入れる| - einschließen[GDJW]1(↔ausschließen)⦅jn.⦆閉じ込める,
拘禁〈収監〉する;⦅et.4⦆(かぎを掛けて)しまい込む,収納する;3(↔ausschließen)⦅et.4 in et.4⦆(…を…の中に)含める‖ in et.3 〈et.4〉 eingeschlossen sein …の中に含まれている|⇛含み込む - einswerden一体になる
[GRIMM] eins
5) neben personen, gleichviel welches geschlechts, und dem verbum subst. bedeutet das praedicierende neutrum eins so viel als identisch, einig, einstimmig, erscheint aber natürlich nur im nom. oder acc.
b) einig: eins sein, convenire. Dasypodius 319c; úneins sein, discordare
wo zween unter euch éines werden (consenserint). Matth. 18, 19;
c) oft fügt sich zu diesem eins der gen. der sache:
sofern wir sonst der sachen éins werden und bleiben, bis das gott weiter schicke nach seinem willen. 6, 113b;
e) die unter b — d vorgetragne bedeutung von eins = einig zeigt sich mhd. noch gar nicht, musz aber aus der naheliegenden von eins = unum unter a entsprossen sein, und oft, z. b. in der stelle bei Göthe 1, 130, läszt sich kaum, welche gemeint sei, entscheiden. wenn aber das neutrum für den begrif der einheit passend erscheint, schickt es sich weniger zu dem des einig werdens; die eines sinnes sind, die sich über etwas einigen oder vereinbaren, sind darum nicht eins geworden.
- eintretenのぼる,入り込む[GDJW]I 1(↔austreten)⦅in et.4⦆(…の中に)入る,
歩み〈立ち〉入る;(団体などに)入る,入会〈入社・入党〉する;⦅bei jm.⦆立ち寄る,訪問する;〘劇〙登場する:(☞treten) - einweihen[GDJW]2⦅jn. in et.4⦆(…に秘密などを)打ち明ける,
知らされる:(ex.) Er ist eingeweiht. 彼はこのことを知っている。[GRIMM]einweihen, inaugurare, consecrare,
4) einen in etwas einweihen, initiare.
b) heute lieber mit in und dem acc.:
- einwilligen[GDJW]⦅in et.4⦆(…に)同意する,(…を)
承諾する: - einwirken[GDJW]II⦅auf jn. ⟨et.4⟩⦆:
影響を及ぼす,感化する,作用する,働きかける,説きつける:(☞Einwirkung) - emanzipieren[GDJW]⦅jn.⦆(支配・束縛などから)解放する,
自由にする,自立させる:[lat. ēmancipāre „aus der väterlichen Gewalt entlassen“; ◇ex..1, Manual, kapieren] - empfangen感受する[GDJW]1 d)(印象などを)
受ける,持つ: - empfehlen[GDJW]I 1 a)⦅jm. et.4⦆(…に…を)勧める,推奨する,⦅jm. jn.⦆(…に…を推薦〈推挙〉する,(積極的に)紹介する:
- empfinden[GDJW]I(肉体的・精神的に)感じる,
知覚〈意識〉する: - empören自憤激させる[GDJW]I他1⦅jn.⦆怒らせる,憤慨〈憤激〉させる:2再帰sich4 gegen jn.〈et.4)~ …に対して反抗する,…に対して反乱を起こす,…に反対して立ち上がる|
[GRIMM]
excitare, aufbringen, aufregen
1) am seltensten erscheint intransitives empören für excitari, effervescere
(☞Empörung) - entäußern[GDJW]⦅雅⦆再帰⦅sich4 et.2⦆~
…を放棄〈断念〉する;…を手放す〈譲渡する〉:(☞veräußern) - entbehren欠いて困る[GDJW]II自⦅雅⦆⦅et.2⦆(…を)欠く:[GRIMM]
beren ist ferre, tragen, entberen wäre wörtlich auferre, enttragen, doch der entbehrende entträgt nicht, nimmt sich nicht, es wird, ist ihm enttragen, genommen, ihm entgeht. entbehren musz also aus einem intransitiven sinn der wurzel entspringen. fasse man behren als bei sich tragen, an sich tragen, haben, so wird entbehren nicht mehr an sich tragen, nicht mehr haben, nicht haben, mangeln, ungefähr wie rathen bedeutet walten, entrathen nicht mehr walten, mangeln.
intransitiv steht das verbum entweder ohne casus oder mit dem gen. der sache, allmälich fand sich auch ein transitiv mit dem acc. ein. das verbum pflegt von adverbien wie leicht, gern, viel, ganz und gar, oder schwer, ungern, kaum, wenig begleitet zu sein. entbehren hat immer bezug auf den entbehrenden, mangeln und fehlen stehn allgemeiner, die ausdrücke es mangelt, fehlt geld werden mit ich entbehre geldes erst durch ein zugefügtes mir gleichbedeutend. missen, vermissen ist auch carere, geht aber auf ein verlornes, bestimmt gesuchtes. darben und bedürfen sind egere, indigere, d. h. bezeichnen noth, die im bloszen entbehren und nicht haben unenthalten ist, sehnsucht und leid kann darin liegen.
- entfernen[GDJW]I 2遠ざける:‖再帰⦅sich4⦆~遠ざかる,
離れる;たち去る;それる:(☞Entfernung) - entfremden[GDJW]1 a)(…を…から)
離反させる,…を…と疎遠にする: - entfremden, sich4 jm. 〈gegenseitig〉~ [GDJW]1 a)…と〈互いに〉疎遠になる:
- entgehen[GDJW]⦅jm./et.3⦆(…を)のがれる,(…を)免れる:
- entgegensetzen対立させる[GDJW]I⦅et.3 et.4⦆
(…に…を)対置する: Vgl. gegenüberstehen,gegenüberstellen - entgegenstellen[GDJW]I⦅jm. et.4⦆(…に…を)対置する;
対抗させる: - enthalten[GDJW]I 1(内容として)含む, 含有する; (中に)もって(入れて)いる:
- enthüllen[GDJW]3⦅雅⦆a)あらわにする,暴露する:再帰sich4 ∼ あらわになる,露呈する:
- entlassen放出する[GDJW]1⦅jn. 〔aus et.3〕⦆(…を(…から))
出してやる,去らせる,解放する(釈放・退院・除隊・卒業など): - entnehmen[GDJW]1 a)⦅et.3〈aus et.3〉et.4⦆(…から…を)取り出す;(…から…を)
借用する: - entscheinden[GDJW]I決定〈判定〉する;〘法〙判決を下す:
- entschließen決断する[GDJW]I 1再帰sich4 zu et.3~
…をする決心を固める;…を選ぶことを決める|sich4 für 〈gegen〉et.4~…を選ぼう〈選ぶまい〉と決心する| [GRIMM]1) aperire, aufschlieszen, öfnen:
6) sich entschlieszen, apud animum statuere, sich entscheiden, endlich hat er sich entschlossen,
(☞Entschluß) - entsprechen[GDJW]I⦅et4⦆1相当(対応)する,合致〈適合〉する,ふさわしい,かなう:
- entsprießen[GDJW]⦅雅⦆⦅et.3⦆(…から植物が)萌え出る;⦅比⦆(abstammen)
由来する: - entspringen[GDJW]1
(川が)源を発する,⦅比⦆⦅〔aus〕et.3⦆(…に)起因〈由来〉する,もとづく、生じる,生まれる: - entstehen[GDJW]発生する,
生まれる,起こる: - entwickeln[GDJW]2展開する,
発揮する:(☞unentwickelt) - ereingnen[GDJW]⦅しばしば時・場所・様態などを示す語句と⦆(事が)起こる,生じる,出来する:
- erfassen[GDJW]3(begreifen)把握する,
理解〈認識〉する: - erfolgen[GDJW]自(s)1⦅事件・現象について⦆(結果として)生じる,起こる:[GRIMM]
2)tr. persequi, verfolgen, einholen, erreichen: mhd.
他成し遂げる - erfordern前もって要求する[GDJW]1(前提として)要求する,
必要とする: [GRIMM]2) etwas erfordern, postulare, exigere, fordern, heischen, verlangen:
heute lieber einfaches fordern, doch noch vielfach:
- erfüllen[GDJW]1 a)満たす,
一杯にする,埋め尽くす:2(義務・任務などを)果たす;(要求・願いなどを)満たす,かなえる,実現させる;〘法〙(債務などを)履行する: - ergänzen補完する[GDJW]1(vervollständigen)(補足して)完全にする,
(…の)不足分を補う,補足する,補充する;増補する,(彫像などを)補修〈修復〉する: - ergeben[GDJW]I 1sich4 ∼
結果として生じる;(…であることが)判明する:結実する - ergreifen掌握する,つけ込む[GDJW]I 1(手で)つかむ,握る;とらえる,捕まえる:2⦅jn.⦆(熱・めまい・恐怖・激情などが…を)襲う;(…の心を)とらえる,感動させる|
- erhalten[GDJW]2(bewahren)b)維持
〈保持〉する,保存する;⦅雅⦆⦅et.4 / jn.⦆(…を)守る:再帰sich4 ∼ 維持〈保存〉される|(☞ Selbsterhaltung) - erheben[GDJW]I他(h)2 b)再帰 sich4 ∼ そびえ立つ:4 a)(上位に)高める,昇格させる:[GRIMM]
1 ... 7) reflexiv in vielen anwendungen.
g) sich eines erheben, damit grosz thun, prahlen:
h) sich zu einem, zu etwas erheben:
nach und nach gieng er (im mahlen) weiter, er erhub sich zum portrait. Göthe 38, 61; sich zur todesverachtung erheben.
成り上がる - erhellen解明される,明白になる[GDJW]II㉂⦅雅⦆⦅aus et.3⦆(事態などが…によって)
判明する:[GRIMM]1) intr. illucescere, patescere:
[DUDEN]2 b. deutlich, verständlich werden; sich [als Folgerung] ergeben
- erinnern内部化する[GDJW]1⦅jn. an et.4⦆(…に…を)
思い起こさせる,想起させる:
思い出す⦅sich4 an et.4 / sich et.2⦆…を思いだす,…を覚えている:
[GRIMM]3) reflexivisch, sich erinnern, meminisse
[WWW]remember (PERF form, PRES force); keep in mind, pay heed to; be sure; recall;
- erklären[GDJW]I 1(klar machen)《jm et.4》
明らかにする,説明〈解明〉する: - erlassen[GDJW]2免除する
[GRIMM]
3) einem etwas erlassen, remittere alicui aliquid:
- erlauben[GDJW]1⦅jm et.4⦆(…に…を)許可
〈容認〉する,許す;(事情などが)妨げとならない,可能にする,許す:[GDJW]2 a)sich4 et.4 ~ …をあえてする,勝手に~を行う:(☞Erlaubnis) - erläutern[GDJW]3解説する,
(…に)註釈〈説明〉を加える: - erleiden[GDJW]1(苦痛・不快・損害などを)こうむる,
受ける: - erleuchten明るく照らす[GDJW]1明るくする,照らす,
照明する;⦅比⦆解明する: - erlöschen鎮まる[GDJW]I自(s)1(火・あかりが)
消える:3⦅比⦆絶える;失効する:[GRIMM]exstingui
- erregen[GDJW]1⦅jn.⦆(…の気持ちを)刺激する,
興奮させる,憤慨(激昂)させる: - erreichen接続する[GDJW]⦅et.4⦆(…に)
届く,到達する;達成する:[DUDEN]1. bis zu etwas, an etwas reichen, um es zu berühren oder zu fassen
- errichten[GDJW]2⦅比⦆設立する,(体系・制度などを)樹立する;〘法〙(遺言状)を作る
- erschöpfen[GDJW]2汲み尽くす,使い果たす,消耗する;⦅jm.⦆疲れ果てさせる,疲労困憊させる :
[GRIMM]
2) gewöhnlich haurire, exhaurire:
3) refl. er erschöpfte sich dadurch also, dasz er umb all das seine kam. Lokman fab. 16; die ursachen haben sich erschöpft die wirkung hervorzubringen. Kant 8, 59;
sich erschöpfenただ~に尽きる[DUDEN]3. a)nur in etwas bestehen, nicht über etwas hinausgehen / Grammatik: sich erschöpfen / Beispiel: mein Auftrag erschöpft sich darin, die Briefe zu registrieren
- erschweren[GDJW]1(さらに)困難にする,妨げる:
- ersetzen[GDJW]1(…の)代理〈代用〉をする;⦅et.4 durch et.4⦆(…を…で)埋め合わせる,補う,(…を…と)取り替える;〘電算〙(…を…に)置き換える〈置換する〉:
- ersparen[GDJW]2⦅jn.〈et.4〉als et.4⦆(無駄・労力などを)省く,
(不快事などを)免れさせる: - erstrecken[GDJW]1再帰⦅方向を示す語句と⦆(…の方に)
延びる,広がる,(…に)わたる,及ぶ: - erteilen授ける[GDJW]⦅jm. et.4⦆(…に…を)与える:
[GRIMM]
ertheilen, ahd. arteilan, irteilan, mhd. erteilen, ags. âdælan, alts. âdêlian. heute auf die bedeutung des austheilens, zutheilens, impertiendi eingeschränkt, während für die des entscheidens, bestimmens, decernendi, judicandi urtheilen eingeführt wurde, doch hat die Bamb. halsger. ordn. von 1507 noch art. 241:
- erwähnen[GDJW]2 b)⦅et.4 / jn.⦆
(…について)述べる,(…に)言及する: [GRIMM]erwähnen, memorare, commemorare, melden, vermelden
1) einem etwas erwähnen, melden:
- erwarten[GDJW]2⦅〔von jm.〕 et.4⦆(たぶん…であろうと〔…に対して〕)
予期する,期待する: - erwecken[GDJW]2(感情・意識などを)呼びさます;
(死者を)よみがえらせる;〘宗〙信仰に目覚めさせる: - erwehren避ける[GDJW]⦅雅⦆再帰 sich4 js. 〈et.2〉~ …から身を守る,…を防ぐ:[GRIMM]
erwehren, prohibere, tueri, defendere,
3) desto häufiger ist das reflexivum,
d) oder es folgt ein abhängiger satz:
- erweisen[GDJW]2 b)⦅jm.〈sich3〉et.4⦆(…が…であることを)証明
〈実証〉する:(☞jm. die letzte Ehre erweisen) - erweitern[GDJW]
広げる,拡大〈拡張〉する: - erwerben[GDJW]I獲得
〈取得〉する,入手する:(☞Erwerb, Erwerbung) - erzälen語る[GDJW]I 1⦅jm. et.4⦆物語る,述べる;(mitteilen)伝える,知らせる:
- erzeugen産出する[GDJW]1(produzieren)(特に農産物を)生産する;
⦅オーストリア⦆(fabrizieren)(商品を)製造する: - existieren現出する[GDJW]1(vorhanden sein)
存在する,ある:現実存在する
F top
- fallen[GDJW]I 1 ③⦅jm.⦆⦅様態を示す語句と⦆(…にとって…の)負担がかかる:
4⦅方向を示す語句と⦆b)⦅比⦆(…の状態に)陥る,落ち込む;
(急に別の状態に)移行する: - fallen, auf
jn.4 [GDJW]5 b)…に向けられる,…に帰属する,…のものとなる: - fallen, in et.4[GDJW]5 d)はいる, 含まれる;
属する:5e)(…の色・傾向を)帯びる: - fassenとらえる,構築準備する[GDJW]4 a)(begreifen)(内容などを)
つかむ、把握する,理解する:b)(auffassen)解釈する: [GRIMM]parere heiszt nicht nur zur welt bringen, sondern überhaupt bringen, vortheil bringen, zu stande bringen, verschaffen;
A) bereiten, rüsten, sowol activisch als medial mit sich gebraucht, meistens folgt die praep. mit, früher also ein instrumentalis.
9) die schlesischen dichter verwenden die medialbedeutung 'sich mit etwas fassen' im sinne von befassen, sich versehen, rüsten, behelfen, decken:
aber auch ohne mit bedeutet allgemein sich fassen se colligere, componere:
B) fassen, tenere, capere, prehendere, amplecti, nehmen, greifen, packen, fangen.
9) fassen, in sich fassen, enthalten, raum für etwas haben, capere:
20) refl. sich fassen, amplecti se, zu unterscheiden von A, 9 se componere.
蔵する (☞auffassen) - et.4 ins Auge fassen[GDJW] Auge1…を注視する,
…をよく考えてみる,…をもくろむ: - fehlen[GDJW]I 1 b)(…が)欠けている,
足りない;見当たらない: - feststehen[GDJW]I
確かである,確定〈決定〉している;安定している,固定されている,(機械などが)すえつけられてある: - festhalten念頭に置く,貫く[GDJW]I他1 a)⦅et.4⦆
しっかりと持っている,固く保持する;(絵・写真・メモなどで)記録しておく;(心に)とめておく:b)⦅jn.⦆ひきとめておく:[GDJW]2再帰sich4 an et.3…にしっかりつかまる,…にしがみつく:II自⦅an et.3⦆(…から)離れない,(…に)固執する: - finden[GDJW]I 1再帰sich4~(探した末に)見つかる;見いだされる;
目に触れる,存在する;⦅相互的に⦆会う,一致する,親しくなる:3⦅jn./et.4⦆⦅様態を示す語句と⦆b)(…を…であると)感じる;思う,評価する:4(feststellen)a)認める,気づく: - fließen流れ出る[GDJW]1 a)(英:flow)(液体・気体・粒状体・川などが)流れる,(時間が)流れる;(言葉などが次々と)出る:
- fixieren[GDJW]1 a)(英:fix)(festhalten)固定させる,
定着〈固着〉させる,据える,(心・記憶に)とどめる;〘心〙(観念を)固定する:(☞befestigen) - folgen(auf et.4)続く,(aus et.3)結論づけられる[GDJW]2⦅et.3/auf et.4⦆a) (時間的に…の)あとで〈次に〉来る,(…に)続く:3⦅aus et.3⦆(…の帰結・結果として)出てくる,(…から)推論される:(ex.)読み取れる。(☞Folge, folgend, verfolgen)
- fordern[GDJW]1⦅〔von jm.〕et.4⦆(verlangen)(〔…に〕…を)要求する,
請求する;⦅et.4⦆(…を)要する,必要としている: - fördern[GDJW]1
援助する,支援〈助成〉する;後援〈庇護〉する;促進〈振興〉する: - formieren[GDJW]1形づくる;
(隊などを)整列させる;(チーム・グループ・党などを)編成する: - fortdauern[GDJW]I持続
〈永続〉する:(☞dauern) - fortgehen[GDJW]2
(weitergehen〉歩き続ける;(fortschreiten〉進行〈進展〉する,(fortdauern)続く,継続〈存続〉する:[GRIMM]1) progredi:
(ex.)er säuft den vollen tag, macht schulden hier und dort, spielt, stänkert, pocht und kriecht, das geht an éinem fort.
Göthe 7, 72 - fortkommen[GDJW]1
(wegkommen)立ち去る,逃げる(abhandenkommen);なくなる,消えうせる: - fortschließen論証を進める[GRIMM]
porro concludere
- fortsetzen[GDJW]I 1先へ進める;続ける,継続〈続行〉する:sich4 fortsezen続く,
連なる: - fragen問う[GDJW]I 1⦅jn.⦆(…に)
質問する,尋ねる,尋ねて言う;(…の)意見〈返答・了承〉を求める:‖〖前置詞と〗〔jn.〕 nach et.3 ∼ 〔…に〕…のことを尋ねる| - freigeben[GDJW]I 3⦅et.4⦆(…の当局による管理を)解除する,(…の使用・公開を)
許可する;(…を)自由化する: - fügen順応する[GDJW]1再帰 sich4 jm. ~
…〔の意思〕に従う: [GRIMM]II3) sich accommodieren, sich nach erfordernis bequemen, sich durch die umstände bestimmt nach oder in etwas schicken, sich nach den umständen oder nachgebend drein finden. diese bedeutung ist erst nhd. und zwar, wie es scheint, im 17. jh. aufgekommen. in ihr aber steht das wort
b) mit dat., bezeichne dieser eine person oder eine sache
- fühlen[GDJW]I 1 a)(肉体的に)感じる,
知覚する: - führen[GDJW]I 1 a)(人・動物などを)
導く,案内する,連れて行く; Vieh auf die Weide ∼ 家畜を草場へ連れ出す|jn. aufs Glatteis ∼ (→Glatteis)| jn. auf den 〈dem〉 rechten Weg ∼ ⦅比⦆…を正しい方向に向かわせる|3 a)携帯する,帯びて〈持って〉いる:et.4 bei〈mit〉sich3~…を携帯している,持ち合せている: - fürgutfinden満足する
[GRIMM]I.A.4)b)γ)
dasz er damit zufrieden sei.
- füttern[GDJW]I 1 a)⦅jn. 〔mit et.4〕⦆(動物、特に家畜に)えさ〈飼料〉を与える:(子供・病人に)食物を与える:
- fallen[GDJW]I 1 ③⦅jm.⦆⦅様態を示す語句と⦆(…にとって…の)負担がかかる:
4⦅方向を示す語句と⦆b)⦅比⦆(…の状態に)陥る,落ち込む;
G top
- gebenもらう,
受け取る[GDJW]3 a)〖sich et.4 geben lassen の形で〗 d)⦅jm / et.4⦆⦅zu 不定詞と⦆(…に…を…)させる,(…に…を…)するようにしむける,(…に…を…)するように促す:
4⦅et.4 / jn.⦆a)⦅et.4⦆①(…を)示す,表す,表現する,述べる,言う,訳す; sich 〔jm.〕 zu erkennen geben〔…に〕自分の素性〈正体〉を明かす、〔…に〕自分の本性を現す - gebrauchen味わう[GDJW]1⦅jn. / et.4⦆(…を)使う,用いる,使用
〈利用)する:(☞Gebrauch) [GRIMM]2) Dennoch musz das ge- ursprünglich eine verstärkung des einfachen wortes bezeichnen, vermutlich ein völliges brauchen, aufbrauchen, wie neben ahd. nioʒan uti, frui mehrfach ganioʒan als consumere erscheint; diesem unterschiede entspricht wol ursprünglich die doppelte fügung mit acc. und gen., so dasz jener eigentlich zu gebrauchen gehört, der gen. aber auch bei gebrauchen eigentlich ein nur theilweises brauchen bezeichnete. ähnlich ist genieszen mit acc. und gen. (vgl. 4, a).
b) auch die von J. Grimm für brauchen gezeigte urbedeutung essen, zehren läszt sich wol noch nhd. erkennen, wie sie noch vocc. angeben, geprauchen vesci neben geprauchen uti, frui im /Bd. 4, Sp. 1827/ voc. 1482 l 7b (vgl. gebrauchung), vesci, gebruchen, essen gemma Straszb. 1518 DD 3d;
4) Die bedeutung ist aber noch genauer zu betrachten, da sie nach mehreren seiten hin eine besondere entwickelung gehabt hat, die doch in den wbb. von jeher unzureichend, zum theil gar nicht beobachtet ist, wie bei gebrauch.
a) gebrauchen gleich genieszen, auch in dessen bildlicher verwendung, und wie bei diesem gewiss unmittelbar aus der bedeutung essen, zehren (s. 2, b) entwickelt.
- gedeihen[GDJW]I 1
栄える,繁栄する;(子供が)成長する,(植物が)繁茂する,(家畜が)増殖する: - gefallnen[GDJW]Isich3 et4 ∼ …を
承認〈甘受〉する,…に反対しない| - gegenübersetzen対向して設定する[GDJW]1⦅jn. jm.⦆(…を…に)
向かい合って座らせる:(☞entgegensetzen) - gegenüberstehen対向する[GDJW]1⦅jm. / et.3⦆(に)
向き合って立つ:(☞entgegensetzen) - gegenüberstellen[GDJW]⦅jn. jm. / et.4 et.3⦆(…を…に)対置する,
対立させる;対比する.(☞entgegensetzen) - gegenübertreten[GDJW]⦅jm. / et.3⦆(…の)前に進み出る;⦅比⦆立ち向かう,
対処する:(☞treten) - gehen[GDJW]I 3 行く:a) ⦅方向を示す語句と⦆(…へ)行く,(…の所へ)出かける,赴く;(…から)出て行く;(…を)通る,経る:in sich4 ∼ 沈思する;反省する|4(↔kommen, bleiben)a)(人が)立ち去る,姿を消す,行ってしまう、居なくなる;〖lassen と:→ gehenlassen〗jn. ~ lassen …を行か〈帰ら〉せる|et.4 ~ lassen …を放置する〈なりゆきに任せる〉|【(comp.)放っておく】I 8 b)非人称⦅es geht jm. 〈mit et.3〉;様態を示す語句と⦆(…の)具合(調子)が(…で)ある:
[GRIMM] gehenII. Bedeutung und gebrauch.
8) Richtung und ziel des gehens.
f) diesz fortgehn, unter umständen bloszes gehn (5, a), deutlicher hingehn ( d. 3), dahin gehn, weggehn (s. 3, a), fortgehn (diesz eigentlich weitergehn), am einfachsten und ältesten abgehn, wird, wie eben mit aus, auch mit einfachem von ausgemalt:
20) Denn auch töne gehn (und tonwerkzeuge), rede, worte u. ä. auch für sich selber, in eigner bewegung gedacht. vgl. auch es geht 36, d, ζ.
c) geradezu für klingen (wie es Adelung u. a. angibt), auch von wort und rede u. a., schon mhd.; nicht blosz vom ausgehen aus dem munde oder eingehen ins ohr:
22) So geht denn auch die zeit, diesz gefäsz aller veränderung; schon goth. anagaggan ἐπέρχεσθαι Eph. 2, 7 (vergl. unter b). von den dingen in der zeit s. 35, a, auch es geht 36, e.
c) das verstreichen der zeit (streichen rasch gehen, reiten u. ä.) heiszt hin gehn, d. h. eigentlich von uns fort, in den hintergrund, auch dahin:
23) Auch das ganze menschenleben wird als ein gehen behandelt, als ein gang in zeit und welt; vergl. lebensweg, lebensgang, bahn (s. unter 32, a), auch mhd. schon, ganz allgemein:
c) auch im einzelnen, wie vom eintritt ins leben:
vom tode, mit bestimmungen, wie den weg aller welt, alles fleisches gehn Adelung, auch einfacher dahin gehen II, 688 oder ganz einfach gehn (franz. s'en aller, vgl. 5, a):
29) Auch dabei tritt aber das selbstgehen der dinge auf, wie in der sinnlichen welt (s. 12 ff.).
a) wie z. b. die gedanken, der geist u. ä. (25, e), die seele (26, d), so gehen
α) auch sorgen, wunsch, triebe, verlangen, zweck (absicht) u. ä. z. b. auf ein ziel (vgl. 24, k), darauf, wenn das ziel vorher oder nachher bezeichnet wird:
aller studien und wissenschaften zweck gehet dahin, dasz man erlerne was das nothwendigste ist. Schuppius 418;
b) in anderem bilde, dem des weges oder ganges dáhin gehn, z. b.: mein streben, verlangen, wunsch gieng immer dahin, die gegensätze zu versöhnen; oder er muszte, wohín auch sein wunsch ging, der gesellschaft eine ganz neue gestalt geben. Göthe 19, 143 (lehrj. 5, 1), worauf er gerichtet war, was man unn vorzieht, das ziel ist dabei wieder deutlicher; s. auch unter d.
c) auch ein vorschlag, antrag bei beratungen geht dáhin, 'meine meinung, mein rat geht dáhin', man möge u. s. w., was in dem alten hingehen nach zwei seiten beim abstimmen (s. 9, h) seinen sinnlichen ursprung hat; sagte man doch im 16. jh. auch noch ich gehe dahin für mein rat, meine meinung, z. b.:
30) Auch spruch, rede, klage, urtheil u. ä. gehn nicht nur aus dem munde (der feder) 20, c, vgl. unter c nachher, sondern auch für sich dann weiter wie wirkende kräfte o. ä., daher auch gericht, recht, strafe geht über einen u. ä.
a) ein spruch u. ä. geht,
β) geht dahin, 'zielt' dahin, hat das im auge (vgl. 29, b):
in sich gehen28) Dazu auch in sich gehn, eigentlich in sein herz; auch griech. εἰς ἑαυτὸν ἐλθεῖν, vergl. in sich kommen unter kommen 30, b, in sich kehren V, 421, diesz schon mhd., s. z. b. 25, a a. e., aber gewiss auch schon gên so. s. auch V, 546 sich erkennen für in sich gehn, sich kennen Liliencr. 2, 238a, sich erkennen 3, 606b. 4, 431b, sich bekennen Soltau 2, 193.
a) in sein herz gehn:
b) in sich gehn:
tabescit
von zerknirschung
dort suchte dich (Elisabeth) der schmeichler nicht. früh lernte, [/] vom eitlen weltgeräusche nicht zerstreut, [/] dein geist sich sammeln, denkend in sich gehn [/] und dieses lebens wahre güter schätzen. [/] Schiller M. Stuart 2, 3.
こころを衝く
gegangenII. Bedeutung und gebrauch.
3) das an sich intransitive wort wird doch auch unter umständen zum trans., tritt auch ins pass. (f), wird reflexiv (h).
g) das part. gegangen aber auch nicht passivisch für sich gebraucht, seltener zwar als z. b. gekommen, eigentlich nur in gegangen kommen (5, f), wo es doch keine perfectbedeutung hat, aber auch ungegangenes tuch, das man nicht hat lassen eingehen (s. d. 7, vgl. unten 15, f) im wasser:
5) Ein nahes begriffliches verhältnis haben auch gehn und kommen, jenes als ein hingehn, dieses als ein hergehn, als fortbewegung und annäherung; zu vergl. ist kommen II, 1, z. b.
f) geläufig ist ihre verbindung in gegangen kommen (s. dort II, 4), sich gehend nähern oder herbeikommen:
- gehenlassen[GDJW]1⦅jn.⦆放任する,自由にさせる,放っておく:
- gehören[GDJW]2 a) ⦅zu et.3 <jm.⦆
(…の)一部〈一員〉である,(…に)〔所〕属する,(…の)中に数えられる:b) ⦅zu et.3⦆(…に)欠かせない,必要である: 3 a) ⦅方向を示す語句と⦆(…に)入れられるべきである,(…に)置かれるべきである,(…に)置くのが当然である: Das gehört nicht hierher. それは関係ないよ(→hierhergehören)| Das Fahrrad gehört nicht in die Wohnung. 自転車は家の中に入れるべきものではない| Die Kinder gohört längt ins Bett. 子供たちはとっくにベットに入っていなくてはいけないのに| Er gohört ins Krankenhaus ⟨Zuchthaus⟩. 彼は入院しなければいけない〈刑務所に入ってしかるべきだ〉| In dieses Haus gehört eine Frau. この家には女手が必要だ|
関与する
[GRIMM]gehören, verstärktes hören, aber mit eigener bedeutsamer entwickelung weit über hören hinaus.
b) auch mit acc. obj. u. ä., ahd. mhd. wie das einfache wort, selten noch nhd.; z. b.:
wo ein deutliches, völliges hören gemeint ist (vergl. d), wie in folgender eingangsformel von urkunden:
c) auch einem gehören, ihn anhören (auch erhören):
wo auch nicht blosz 'geneigtes gehör' (s. u. 1DWb gehör 5, a) gemeint ist, sondern zugleich erhörung, wie gehör 4, d a. e., ahd. gihôrian exaudire, auch mit acc., z. b.:
4) vom verhältnis der angehörigkeit, der sippe, heimat.
b) früh schon wird diesz gehören verstärkt oder verdeutlicht mit an oder zu (vgl. 5, c). wie noch jetzt die frage auch lautet wem gehörst du an? so im 14. jahrh.:
11) von der rechten stelle wo einer oder etwas hin gehört, die ihm zukommt, auch wo es sein sollte und nicht ist u. ähnl.
b) ebenso dann von dingen: wo gehört das hin? fragt im hause die mutter das kind, um es an ordnung zu gewöhnen, thus wieder hin wo es hin gehört, es gehört in den schrank, auf den tisch u. ähnl.; diese figur gehört auf den schrank.
- gelten[GDJW]
I他(h)1⦅数量を示す4格と⦆a) ①(有価証券などが…の)価値〈値うち〉がある,(…に)値する:②⦅比⦆(人・事柄などが…程度の)重要性がある,(…程度に)重きをなしている(→II 1 b):
II自(h)1 a)(gültig sein)
(その本来の)価値〈効用〉を有している,認められている,有効である,通用〈妥当〉する;重みをもつ,ものをいう:〖gelten lassen の形で〗et.3 ~ lassen…を(正しいもの・もっともなこととして)認める|〔通用する(通る)と認める〕b)⦅alsやfürを伴う形容詞または名詞と⦆(…と)見なさ〈思わ〉れている,(…で)通っている: [GRIMM]8) ferner überhaupt von anerkanntem wert aller art, der sich auch in gunst und ansehen als kraft und wirkung oder einflusz äuszert, was in dem vielseitigen geltung zusammengefaszt wird, oft noch erkennbar oder denkbar mit anschlusz an den marktwert von geld oder waare, aber auch aus einer andern quelle im alten leben (die unter 9 deutlicher wird).
b) besonders auch rede, worte u. ä. gelten, wie gültiges geld, zugleich von der wirkung die sie bei andern haben.
β) der begriff der wirkung bei andern tritt auch noch deutlicher und für sich besonders hervor: gelten, vermögen, kraft haben, valere, pollere, autoritatem habere Aler 887a, z. b.:
g) vielgebraucht ist auch gelten lassen, seit dem 16. jh., vermutlich älter (vergl. a. e.):
- geltend machen通用させる[GDJW]III 1 a)⦅et.4 geltend machen の形で⦆①(vorbringen)(意見・権利などを)
主張する:②i)…を行使する,…にものを言わせる;∇ii)…の効果〈真価〉を発揮させる(= et.4 zur Geltung bringen):2 b)⦅sich4 geltend machen の形で⦆効力(影響・徴候)が現れる,目に見え〈感じられ〉てくる: - gelangen[GDJW]2⦅zu et.3⦆a)(…の)状態になる: zu Ansehen 〈zur Macht〉~名望〈勢力〉を得る
- geschehen[GDJW]I 1(sich ereignen)(事が)
起こる,生起する,生じる,行われる:2(widerfahren)⦅jm.⦆(事が…の)身に起こる,(…の)身に降りかかる: - gestalten形態化する[GDJW]
形づくる,形成〈構成〉する,造形〈具体化〉する:(☞Gestalt) - gestatten[GDJW]1⦅jm. et.4⦆(…に…を)
許す,許容する: - gewähren授ける[GDJW]I⦅jm. et.4⦆1(希望するものを)
与える,認める:2(希望を)みたす: [DUDEN]1a [jemandem etwas, was er erbittet oder wünscht, aus Machtvollkommenheit] großzügigerweise geben, zugestehen - gewinnen勝ち取る[GRIMM]
I … 2) … c) der allgemeinere begriff einer besitznahme läszt die verschiedensten deutungen zu. aus einer abschwächung und verallgemeinerung der sp. 5932 belegten verwendungen erkämpfen, erbeuten sind sicherlich zahlreiche verwendungen zu erklären, wozu ja auch die synonyma (s. o.) ihre parallelen bieten. schwerer wird es, bei gewinnen auf die begriffe arbeit, mühe zurückzugehen, die aus winnen herauszuholen sind, vgl. DWB gewinn, labor (sp.5864), vgl. laboribus exigunt ut moriantur, kiwinnit (zu Gregor, cura past.). Steinmeyer-Sievers 2, 205. in allen einzelheiten die eine oder die andere wurzel (kampf, arbeit) bloslegen zu wollen, wäre bei gewinnen gerade so fruchtlos wie bei erwerben (s. d.); doch ist überall da, wo die anhaltspuncte einigermaszen zureichen, die frage wenigstens erörtert.
- gewöhnen[GDJW]⦅jn. an et.4〈jn.〉⦆(…を…に)
なじませる,慣れさせる: - gründen基礎づける[GDJW]他I 1(…の)基礎を置く〈築く〉;創設〈創立・設立〉する,建設する,結成する:2⦅et.4 auf et.4⦆(…を…に)基づかせる:II自1⦅auf ⟨in⟩ et.3⦆(…に)基づいている:
- gutgehen[GDJW]I 1非人称⦅es geht jm..〈mit et.3〉 gut⦆(…の健康・経済状態などが)良い状態にある,具合〈調子〉が良い(→gehen I 8 b):
- gebenもらう,
H top
- haben[GDJW]
I⦅ふつう受動態なし:→bekommen⦆(英:have)持っている:
1(halten)保持している:a)⦅場所を示す語句と⦆(…を…に)持っている,(…を身体の…に)つけている,持ちあわせている:
〖空間的〗
haben, jn. vor sich3…と向きあって〈…の背後に〉いる|
〖抽象的〗
haben, et.〈jn.〉 vor sich3…と相対している,…を目前にしている|
c)(交渉を)維持する,保つ:
〖es を目的語とする言い回しで〗
es mit jm. ∼ i) …と〔恋愛〕関係がある;ii) …と話しあう必要がある;iii)…と事をかまえている|
〔es〕 mit et.3 ∼ …を重視する|
2 備えている,(…が)備わっている(→5)b)(…の)性質〈状態・事情〉を備えている:c)⦅es, nichts などの目的語とする言い回しで⦆
haben, auf sich4 Was hat es damit auf sich? それにどんな意義があるのか。
3⦅自分の意志によらない受動的行為・状態⦆a)与えられている,付与されている,負わされている:
‖〖zu 不定詞〔句〕と:→sein1 1 4〗Wir haben nichts ⟨es⟩ mit ihm zu tun. 我々は彼と何のかかわりもない〈かかわりがある〉‖
c)⦅話⦆(聞いて)知っている;〔すでに〕経験している;(学校などで)教えられている:(ex.) Das haben wir alles schon gehabt. そういうことは全部わかっている(経験ずみである)| 5a)(…)である,(…)がある:ex.) Wir haben heute schönes Wetter. きょうはいい天気だ(= Es ist heute schönes Wetter.)6⦅本来の意味が希薄化して,目的語の名詞のほうが述語の意味を担う言い回しで⦆…する:
[GRIMM]B. Bedeutung.
I. Halten, fassen, umfassen.
2) der sinnliche begriff des haltens kann dauer gewinnen und geht alsdann in den begriff des führens, tragens über. so haben wir gegenstände, die lange zeit oder für immer mit uns verbunden sind, gegenstände z. b. der kleidung, die unser körper längere zeit trägt, körpertheile selbst;
was aber jene zwo verklerung in sich haben (welchen sinn sie in sich führen, was sie bedeuten) ist gnug gesagt. Luther 6, 179b
Anstatt der localen präpositionen steht zu oder als bei haben, und es wird nun statt des ortes der zweck des tragens hervorgehoben: er hatte seinen mantel zur decke oder als decke;
II. Der begriff unseres wortes geht von seiner ersten bedeutung halten zu dem begriffe haben, besitzen, in manigfachen abstufungen und schattierungen über.
3) am meisten steht haben in der bedeutung zu eigen haben, im besitze haben; bei der ungemein häufigen anwendung des wortes hebt sich die bedeutung bald mehr, bald weniger scharf hervor. das einfache object ist in den accusativ gesetzt, seltner in den theilungsgenitiv, es wird auch in gangbaren und sprichwörtlichen redensarten als leicht zu supplieren, ganz ausgelassen:
b) eigenschaften, geistige gaben, alter, gründe, recht, pflicht u. s. w. haben:
jederman sei unterthan der oberkeit, die gewalt uber in hat. Röm. 13, 1;
e) dem objecte folgt ebenfalls ein infinitiv, aber durch zu vermittelt, und den zweck hervorhebend. auch hier schwankende bedeutung von haben.
β) in andern fällen bezeichnet haben nur das vorhandensein der notwendigkeit jener bezweckten handlung: ich habe etwas zu thun, für mich ist etwas zu thuendes vorhanden; was haben wir zu thun? ich will mit der sache nichts zu thun haben; was haben wir mit dir zu schaffen? Luc. 4, 34; wer wieder sagt dasz du eine närrin bist, der hat es mit mir zu thun. Lessing 2, 174. dieses 'zu thun' oder 'zu schaffen' musz in manchen sätzen nur verstanden werden: packe dich, du hast nichts mit uns, wir nichts mit dir (zu schaffen). Göthe 42, 412; die Schnotterbaum lag die nacht durch in wüthenden krämpfen, was uns weiter nichts angieng, denn wir hatten es nicht mit ihr, sondern mit ihrem miethsmanne (zu thun). Immermann Münchh. 2, 148;
- haben, et.4 an sich3身につけている[GDJW]anI2a)(an にアクセントがある)…を〔身に〕備えて〔持って〕いる|Er hat nichts vom Schulmeister an sich. 彼には教師臭いところが少しもない|Mein Vater hat die Gewohnheit an sich, mittags zu schlafen. 私の父には昼寝をする習慣がある|Er hat etwas an sich. ⦅話⦆彼には独特な〈妙な〉ところがある.
- haben, et.4 vor sich3[GDJW]sich1 b) ⑤まだ…をしなければならない|
- haben, jn. et.4 nötig[GDJW]…を必要とする
- halten[GDJW]1 c)(zurückhalten)引きとめる;⦅比⦆抑止する:||再帰 sich4 ∼ 自制する(ex.) Mich hält in dieser Stadt nichts mehr. 私をこの町に引きとめるものはもう何もない,私はこの町にもうなんの未練もない.
3 ⦅et.4⦆⦅様態を示す語句と⦆(…が…であり続けるよう)気を配る;(…を…の状態に)保つ: 3 b) 〔treu〕zu jm. halten…の側〈味方〉につく: [GRIMM]I 2)
c) in bezug auf sachen und personen: sich zu einer sache halten, sie angehen, sich ihr zuwenden und sie in besitz nehmen:
関与する
4 c) sich.4 an et.4 halten…を尊重する;…(とりきめなど)を守る;…に準拠する:
5 ⦅しばしば für を伴い,様態を示す語句と⦆(…を…と)見なす,考える,評価〈判断〉する:(ex.) et.4 für wahr 〈sicher / gewiß〉 ~ …を真実〈確実〉であると思う| - handeln行為する[GDJW]I 1 a)(英:handle)a)
行動する;2(behandeln)⦅von et.3 / über et.4⦆(…を)題材にする,(著者・論文などが)扱う: - häufen[GDJW]I 1積み上げる,積み重ねる;⦅比⦆集める,集積する,ためる:
- hegen[GDJW]1 a)(植物や動物を)育てる,育成する:
- heißen[GDJW]
I 2(…ということを)意味する,(…という)意味である:〖das を主語として〗das heißt(略⃝ d.h.)すなわち,いいかえると,つまり;ただし(=das ist)|
4非人称⦅es heißt⦆a) (…という)うわさである,(…と)言われている:b) (gelten)(…が)問題である,(…が)必要である:
II 1⦅jn. / et.3 のほかにさらに4格または様態を示す語句を伴って⦆a)(…を…であると)称する,
言う,呼ぶ,(…を…と)見なす: - herabfallen落ち込む[GDJW]
こちらに落ちる,落ちて来る: - herabsetzen[GDJW]1(数量を)引き下げる;
下落〈減少〉させる,縮小〈削減〉する;(品質・価格などを)低下させる;(…の)価値を引き下げる: - herabsteigen[GDJW](上から)おりて来る:
- herabwürdigen尊厳を踏み躙る[GDJW]⦅jn.⦆(…に対して)その地位〈名誉〉にふさわしくない扱いをする,(…を)軽んじる;おとしめる,けなす,誹謗する:
- herausarbeiten[GDJW](素材から完成品を)作り出す;
⦅比⦆浮き彫りにする,際立たせる;⦅話⦆(居残り・早出などで)時間を浮かす: - herausbringen[GDJW]3⦅話⦆
(栓・釘・衣服のしみなどを)抜き取る;⦅et.4 aus jm.⦆(情報・返答などを…から)引き出す,聞き〈探り〉出す;(問題を)解く,(解答・真実などを)発見する: - herausgehen超えて行く[GDJW]3⦅über et.4⦆(…を)超え〔て出〕る:
- herausheben[GDJW]1(こちらへ)持ち上げて出す,取り出す,
(人を車などから)助け降ろす:2(周囲のものから)際立たせる,強調する: - herauskommen[GDJW]1
外へ出て来る;外出する;⦅話⦆刑務所から出る;(星や月などが)出る,(植物の芽などが)顔をのぞかす,現れる,(煙などが)出てくる;(苦境から)脱出する;⦅話⦆調子はずれになる:(ex.)抜け出す - herausnehmen[GDJW]1(中から外へ)取り出す,取り除く,
はずす: - heraussetzen公布する,外に設定する[GDJW]1 a)⦅et.4⦆
外へ出す,外に置く:[GRIMM] - setzenzwingt ihn zum verlassen der gemietheten wohnung. übertragen, hervorheben, in einer darstellung, einer schilderung: da er mir denn den werth und die würde dieses documents (der goldenen bulle) sehr deutlich herauszusetzen wuszte. Göthe 24, 248;
- herausstellen[GDJW]1外へ出す,
外に建てる〈置く〉;〘スポーツ〙(反則者を)退場させる: - heraustreten[GDJW](中から)
あゆみ出てくる;現れ出る;(身体の一部などが不自然に)飛び出る:(☞treten) - herbeibringen[GDJW]
こちらへ持って〈つれて〉来る;(証拠などを)持ち出して来る: - hereintreten入り込む[GDJW]
入って来る,足を踏み入れる:(☞treten) - herkommen出てくる[GDJW]I 2⦅場所を示す語句と⦆(…の)出である;
(…に)由来〈起因〉する: - herleiten[GDJW]1⦅et.4 aus 〈von〉 et.3⦆(…を…から)導き出す:
- hernehmen[GDJW]1⦅場所を示す語句と⦆(…から)取って来る:
- herrschen[GDJW]1支配する,
治める,統治する: - herstellen[GDJW]2(努力してある状態を)作り出す,確立する,打ち立てる:3(wiederherstellen)
修復する,復元する;(病気などを)治療させる:[GRIMM]- ) an einen ort nach einem sprechenden zu stellen, von personen und sachen:
- ) daher ausliefern, überliefern, in eines gewalt übergeben:
- ) neuer ist herstellen in der bedeutung in den ursprünglichen zustand zurückversetzen, es ist nur eine kürzung von wieder herstellen, zerbrochenes oder zerfallenes wieder ganz und stehend vor augen bringen::
- herüberbringenこちら側に持ち来たらす[GDJW]こちら側へ運んでくる:
- herübergehenこちらへ超えて行く
- herum
[GRIMM]
1) herum, örtlich, als ein verstärktes, dem ziele nach bestimmtes um, zum ausdruck einer kreis- oder bogenförmigen bewegung oder richtung, die eigentlich nach einem sprechenden oder dem mit ihm in nächster beziehung stehenden orte zu ihren abschlusz findet; ein früher vorhandener gegensatz hinum ist indes der schriftsprache jetzt verloren gegangen (vgl. an alphabetischer stelle), daher denn der hinweis auf den ort des sprechenden nicht immer scharf mehr hervortritt. die bewegung kann nach ausdehnung und verlauf eine sehr verschiedene sein, wobei das zum adverbium gesetzte verb oft wesentlichen einflusz hat, sie drückt in manchen fällen ein zurück aus, vergl. unten bei herum lenken, schwenken, werfen, daran schlieszt sich die formel hin und herum, ausdehnung nach einem punkte und wieder zurück angebend:
- herumtreibenさまよう[GDJW]I他1再帰sich4 ∼ あてもなく(あっちこっち)ほっつき歩く:(ex.) sich4 in der Welt ∼ 諸国を放浪する|sich4 in Kneipen ∼ あちこちの飲み屋に出没する|Sie trieb sich4 mit einem jungen Mann herum. 彼女はある若い男と遊び歩いた.∼ を弄する
- herumwerfenまき散らす,意を翻す[GDJW]1
まわりに投げる,投げ散らす:2すばやく回転させる,くるりと裏返す;急に向きを変える: - hervorbrechenにわかに湧き起こる,(花が)にわかに咲く[GDJW]1
急に飛び出してくる;突然現れる;(液体が)ほとばしり出る;(感情などが)急に起こる:2おおいを破って現れる - hervorbringen[GDJW]1生み出す,
産出する;(印象などを)ひき起こす: - hervorgehen出て行く[GDJW]⦅aus et.3⦆1(…から)発する,(…に)由来する,
源は(…に)ある,(…の)出である。:2(…の)結果として出て来る,生じる:3(…から)読み取れる,推定される,判明する,わかる:
[DUDEN]- in etwas seinen Ursprung haben
- aus einem [Wahl]kampf, einem Wettbewerb, einer Krise o. Ä. in positiver Weise herauskommen
- sich als Folgerung aus etwas ergeben; sich aus etwas entnehmen lassen
- sich allmählich stufenweise unter bestimmten Bedingungen, durch bestimmte Einwirkungen entwickeln
- hervorheben[GDJW]際立たせる,
強調する: - hervorkommen[GDJW](…から)
出てくる,姿を現す,現れる: - hervortreten[GDJW]1(…から)
歩み出てくる,進み出る,出現する:2(不自然に)飛び出る,突き出る,出っ張る:(☞treten) - hervortun[GDJW]1再帰sich4 ∼ 頭角を現す,
ぬきんでる: [GRIMM] hervor thun1) transitiv, machen, dasz etwas hervor kommt:
2) reflexiv, hervor kommen, sich äuszern, zeigen, einstellen:
- hierhergehören[GDJW]2
(分類などで)ここに所属する;これと関連する,ここにふさわしい: - hinaufschraubenくるくると舞い上がる[GDJW]2再帰sich4 ∼ (鳥・飛行機などが)旋回しながら舞い上がる:
- hinausgehen(外へ)超えて行く[GDJW]3⦅über et.4⦆(…を)超え〔て出〕る:
- hinauskommen[GDJW]2über et.4 nicht ~ …から先に進まない:
(…に)帰着する[GDJW]3⦅auf et.4⦆(…に)終わる,(…という)結果になる: - hinauslaufen[GDJW]2⦅auf et.4⦆(…という)結果になる,(…を)目的としている:(☞ankommen)
- hinausschicken外へ追い出す[GDJW]使いに出す;(部屋などから)外へ〔追い〕出す:
- hinaustreiben外へ追い立てる[GDJW]I(家畜を)外へ連れ出す〈追い立てる〉;⦅jn.⦆追い立てる(払う):
- hinausweisen[GDJW]II㉂外の方を指示する:
- hinauswerfen[GDJW]外へ投げ〔捨て〕る,ほうり出す:⦅話⦆⦅jn.⦆おっぽり出す,くびにする:
- hindeuten[GDJW]2⦅auf et.4⦆(…を)示唆
〈暗示〉する: - hindern[GDJW]1⦅jn. an 〈bei /in〉 et.3⦆(…が…するのを)妨げる,
邪魔する;阻止する: - hindurchblicken(☞hindurch,blicken)
- hindurchdringen突き抜ける[GRIM] hindurch
adv. durch und hinwärts
1) in räumlicher bedeutung ist es das verstärkte durch, indem hin die bewegung, die in durch liegt, rücksichtlich des entfernteren endes und zieles nur kräftiger hervorhebt; vgl. auch theil 2 sp. 1569. das adverb hindurch steht sowol in sinnlicher schärfe, wie übertragen, mit verben der bewegung, wie
dringen: - hindurchgehen[GDJW]通り抜ける:
- hineingehen[GDJW]1入っていく:
- hineinlegen[GDJW]1⦅et.4 in et.4⦆
(…を…の中へ)入れる;(感情などを)投入する,こめる:(ex.)「はさむ」。 - hineinbringen[GDJW]1⦅jn. 〈et.4〉 in et.4⦆(…を…の中へ)持ち(つれ)込む;⦅et.4 in jn.⦆(…を…に)納得させる:
- hineinzwängen[GDJW]1⦅et.4 in et.4⦆むりに押し込む⦅sich in et.4⦆体をむりに…〔の中〕に押し込む:
- hinreichen[GDJW]I⦅jm. et.4⦆(手)渡す:
- hinstellen[GDJW]1(ある場所に)置く,立てる,据える;配置する,ポストにつける:
- hintansetzen[GDJW]あと回しにする,最後に置く;無視〈軽視〉する,ないがしろにする,考えるのをあと回しにする.
- hintergehen不意打ちする[GRIM] hintergehen
verb. 1) hinter einen gehen, im falle der kriegführung und verfolgung, überrumpeln (vgl. hinter II, 2, b sp. 1491):
- hintreten[GDJW]1(ある方向に)足を踏み出す:(☞treten)
- hinübergehenあちらへ超えて行く[GDJW]向こう側へ渡って行く:
- hin- und her gehen[GDJW]hin1 d)あっちこっち歩き回る;行きつ戻りつする
- hinweghebenほかのところに取り上げる[GRIM] hinwegheben: hinwegheben, amovere, auferre Stieler 807;
- hinwegnehmenほかのところに取り除かれる[GRIM] hinwegnehmen: den raub hinwäg nemmen, spolia adimere.Maaler 225c;
- hinweisen[GDJW]I⦅jn. auf et.4⦆
(…に…を)指示〈指摘〉する,(…に…の)注意を喚起する - hinzukommen[GDJW]2(別の事情などが)さらに付け加わる:
- hinzufügen[GDJW]⦅〔zu〕et.3 et.4⦆(…に…を)付け加える,付加〈添加〉する;付言〈補足〉する:(☞hinzusetzen)
- hinzusetzen[GDJW]1☞hinzufügen
- hinzutreten[GDJW]2(仲間に)加わる,参加する;(新たな事情などが)つけ加わる:(☞treten)
- hören[GDJW]I 1⦅聴覚的⦆(英:hear)耳で知覚する:‖〖zu のない不定詞〔句〕と;完了形ではしばしば gehört の代りに hören を用いて〗…| sich4 gern 〔reden / sprechen〕~(自分の話しぶりに自信をもっていて)おしゃべりである(sich は hören の目的語) 2⦅精神的知覚⦆a)(人から)聞き知る,(…について)聞く,耳にする,(…についての)情報を得る:et.4〉〔von jm. 〈durch jn.〉〕 ~ …を〔…から〈…を通じて〉〕聞く|von jn. 〈et.3〉 et.4 ~ / über jn. 〈et.4〉et.4 ~ …に関して…を聞き知る~|
- haben[GDJW]
I⦅ふつう受動態なし:→bekommen⦆(英:have)持っている:
1(halten)保持している:a)⦅場所を示す語句と⦆(…を…に)持っている,(…を身体の…に)つけている,持ちあわせている:
I top
- inhärieren[GDJW]内在〈内属〉する,
先天的に備わっている: - inkulkieren[LWWW] inculcareforce upon, impress, drive home:(押しつける、印象づける、(人に)(…を)納得させる、よく理解させる、(…を)強調する):
- integrieren[GDJW]I 1 a)(部分・要素を)統一体にまとめる,全体にまとめて一本化する,統合する,
集大成する;(由来・所属による区別を廃止して…を)融合統一する: - interessieren利害関心を起こさせる[GDJW]I 1⦅jn.⦆(…に)興味〈関心〉を起こさせる:
- innewohnen[GDJW]I 1 a)⦅雅⦆⦅et.3 / jm. ⦆(…に)内在する,
本来備わっている,固有である: - inwohnen内に住み着く[GRIM]
verb. die gekürzte form für inne wohnen (spalte 2126):
: - isolieren[GDJW](absondern)1隔離する,隔てる;(社会的に)孤立させる:
- inhärieren[GDJW]内在〈内属〉する,
K top
- kennen[GDJW]1⦅ふつう受動態なし⦆⦅jn. / et.4⦆(直接に体験して)
知っている:a)(…と)知り合いである;見たことがある;熟知している,(…に)精通している:2⦅et.4⦆(…が…を)関知している,(…には…が)ある:〖否定文で〗ex.) keine Unterschied ~ 差異を認めない,区別しない|
★ kennen と wissen の違い:〔…〕ii) kennen が直接見聞した体験に基づいて知っているというのに対し、wissen は〔間接的に〕知識・情報として心得ているという意味で用いるのが中心的用法である:den Weg kennen その道を以前通ったことがある|den Weg wissen 道順を心得ている. - kommen[GDJW]
I(英:come)
1(話し手〔の視点〕に向かって)近づいて来る:
a)⦅空間的⦆来る,こちらへ移動する,こちらへ方向をとっている:〔wieder〕 zu sich4 ∼ 正気を取り戻す,我に返る‖〖出発点を示す語句と〗aus allen Richtungen ∼ 四方八方からやって来る|みずからに戻り来って正気となる
b)⦅抽象的⦆①(ある状態)になる:aus der Mode ∼ 流行おくれになる|
3 a)(人が)運び込まれる,収容される: ins Gefängnis ~ 刑務所に収容される.|ins Krankenhaus ~ 病院に運び込まれる.注入される
c)⦅jm.⦆(…の頭に)
浮かぶ,思いつく,(考え・怒りなどが)生じる,わく:湧き出てくる 5 c)⦅auf et.4 / hinter et.4⦆ (…に)思い至る,気づく: 6 b)⦅zu et.3⦆(…を)手に入れる,(…に)ありつく: Ich bin zu der Überzeugung gekommen, daß ... 私は…という確信を持つに至った‖ 13⦅不定詞〔句〕と⦆a)⦅zu 不定詞〔句〕と⦆(…するに)至る,(…することに)なる: [GRIM]II. Gebrauch und bedeutung.
30) Besondere aufführung verdient kommen vom bewusztsein und gefühl seiner selbst, die auch in der sprache aufgefaszt werden als wären leib und seele zwei personen, oder als könne der sinn sich theilen, daher bei sich oder auszer sich sein (s. 1, 1031), sich verlieren, aus der haut fahren u. a.
b) diesem aus sich kommen entsprach als gegensatz in sich kommen (auch gr. εἰς ἑαυτὸν ἐλθεῖν):
so haben wir noch in sich gehn, 'sich auf sich besinnen', vergl. so in sich kehren, sich zu sich selbst kehren sp. 421.
c) dem verlorenen von sich kommen aber entspricht doch noch zu sich kommen, das auch schon mhd. bestand:
damit sie von irer vermessenheit ein mal zu sich selbs kemen. Luther 3, 4a; da er wider zu sich selbs kam (vom schrecken). Judith 13, 30;
- aus sich kommenみずから湧きあがってくる
- außer sich kommen(みずからの外に出て)みずから(sichであることを)を忘れる[GDJW]sich 1b)⑤außer sich sein 我を忘れている:
[GRIM]- Gebrauch und bedeutung.
- ) Besondere aufführung verdient kommen vom bewusztsein und gefühl seiner selbst, die auch in der sprache aufgefaszt werden als wären leib und seele zwei personen, oder als könne der sinn sich theilen, daher bei sich oder auszer sich sein (s. 1, 1031), sich verlieren, aus der haut fahren u. a.
- ) so mhd. von im selben kumen, sich selbst verlieren, eig. von seinem ich sich entfernen:
Jetzt nur auszer sich kommen, was aber der klarheit jenes 'von sich kommen' entbehrt und wol nur von auszer sich sein herrührt (daher der wunderliche dativ auch bei kommen): nur von der bloszen erinnerung komm ich auszer mir. Göthe 8, 48; wenn ihr sie seht und nicht auszer euch kommt (vor entzücken, liebe). 8, 49. - ) diesem aus sich kommen entsprach als gegensatz in sich kommen (auch gr. εἰς ἑαυτὸν ἐλθεῖν):
- ) so mhd. von im selben kumen, sich selbst verlieren, eig. von seinem ich sich entfernen:
- ) Besondere aufführung verdient kommen vom bewusztsein und gefühl seiner selbst, die auch in der sprache aufgefaszt werden als wären leib und seele zwei personen, oder als könne der sinn sich theilen, daher bei sich oder auszer sich sein (s. 1, 1031), sich verlieren, aus der haut fahren u. a.
- Gebrauch und bedeutung.
- jm. 〈et.3〉~ kommen[GDJW] zugute…の利益になる,…の役に立つ,…の助けとなる|
- können[GDJW]I(英:can)⦅話法の助動詞として、他の動詞の不定詞とともに用いられ、その場合過去分詞には不定詞の形が用いられる.文意が明らかな場合には本動詞を省略することがあり,その結果4格の目的語だけが残って、他動詞的用法に近くなることもある⦆1 a)⦅各種の能力・可能性を示して⦆…することができる;…する能力がある,…のしかたを知っている;…し得る,…られる;…が〔実現〕可能である:b)⦅許可を示して⦆…してもよい,…してかまわない:
- kundgeben[GDJW]⦅雅⦆知らせる,
表明する - kundtun[GDJW]⦅雅⦆(kundgeben)知らせる,
表明する
- kennen[GDJW]1⦅ふつう受動態なし⦆⦅jn. / et.4⦆(直接に体験して)
L top
- lauten[GDJW]1 a)(文章などが…のように)述べている、(…という)言葉〈文面〉になっている:ex.) Der Brief 〈Der Befehl〉 lautet wie folgt. 手紙〈命令〉の内容は次のとおりである.
- lassen[GDJW]I 1 b)⦅放置・放任⦆② i)(überlassen)⦅jm. et.4⦆(…に…を)ある目的のために置いて〈残して〉いく,あずける,ゆだねる;〈ある価格で〉置いていく,ゆずる:ii)(hinterlassen)(…のために…を)あとに残す;遺産としてのこす:2 c)⦅再帰的に⦆(一種の受動的な表現として;lassen の本来の目的語は普通表現されないが,必要ある場合は von jm. の形で表現される⦆①⦅sich4+不定詞+lassen の形で⦆i)⦅黙許・容認・放置⦆ⓑ⦅事物を主語として⦆⦅可能⦆…され得る,…できる:
[GRIMM]
B. Bedeutung und gebrauch.
I. lassen, intransitiv oder transitiv.
3) lassen verbindet sich mit einem objecte, etwas oder einen weichen machen, von sich lassen, entlassen, fortlassen, fahren lassen; in mehrfachen fügungen.
5) nahe zur bedeutung 3 steht lassen, abstehen von etwas, unterlassen, sein lassen.
c) lassen, mit seinem gegensatz thun formelhaft verbunden:
wir wissen so gut was wir wollen als ihr, und (was wir) haben zu thun und zu lassen. Göthe 8, 142;
(☞thun)
Sie gehen also solchen regungen allzeit durch eine natürliche nothwendigkeit nach, dergestalt, daß ob sie gleich, nach dem unterschiede der empfindungen der ihnen vorkommenden dinge, das, was sie thun, auch lassen können, dennoch aus der einen empfindung das thun, aus der andern das lassen, durch eine natürliche nothwendigkeit unausbleiblich erfolget. Der mensch hat diese natürliche Freyheit auch; er kan das, was er thut, auch lassen, und was er läsest, auch thun: aber keines von beyden, nemlich weder das thun noch das lassen, muß in ihm bey empfindung ie eines objects durch eine natürliche nothwendigkeit, wie in den bestien, geschehen.
August Friedrich Müller, Einleitung in die Philosophischen Wissenschaften, Erster Theil, welcher den Eingang, die Logic, und Physic in sich enthält, zum Gebrauch seiner Academischen Lectionen abgefasset, Zweyte, vermehrte und verbesserte Auslage, Leipzig 1733 (Google), S. 11 f. - legen[GDJW]6⦅et.4 in et.4⦆(…を…の)状態にする:
- leiden受苦する[GDJW]I他1苦しむ,悩む:II他1(…に)悩む;(被害を)こうむる:
[GRIMM]- Bedeutung und gebrauch.
- leiden, intransitiv.
- ) zusätze mit präpositionen geben grund-, zweck- und artbestimmungen. es heiszt um eines willen leiden:
von dem feinde haben wir viel gelitten; wir hatten vom durste zu leiden;
und da duftets wie vor alters,
da wir noch von liebe litten.
Göthe 5, 18
- ) zusätze mit präpositionen geben grund-, zweck- und artbestimmungen. es heiszt um eines willen leiden:
- leiden, intransitiv.
- Bedeutung und gebrauch.
- leisten履行する[GDJW]1 a)(仕事を)果たす,なしとげる:[GRIM]
1) leisten, einer verpflichtung nachkommen, etwas schuldiges thun oder erfüllen:
- leiten[GDJW]II ∇1⦅auf et.4⦆(…に)導く,到達させる:
[GRIM]
1) mit persönlichem subject und object, jemand einen weg, dessen ziele entgegen, weisen, wobei gemeiniglich zugleich die persönliche führerschaft verstanden ist:
nhd., zunächst ohne angabe eines zieles:
das subject ist ein als person gedachtes abstractum:
mit adverbialen oder präpositionalen zusätzen, die weg oder ziel zeichnen:
mit dergleichen zusätzen, welche art oder mittel des leitens bezeichnen:
und das mittel oder werkzeug kann auch als subject stehen:
6) leiten, mit dem sächlichen subject des weges, der irgend wohin führt:
am abgrund leitet der schwindlichte steg, / er führt zwischen leben und sterben. / Schiller berglied.
- liegenもともと…(で)ある[GDJW]5⦅本来の意味が薄れて sein に近い機能で⦆a)⦅様態を示す語句と⦆…の状態である:b)⦅場所や位置関係を示す語句と⦆①(…に)ある,(…に)位置している,位置が…である(→gelegen II 1):②⦅比⦆⦅順位・水準・数値などに関して⦆(…の)位置を占める:
[GRIM]
II. Bedeutung und gebrauch.
liegen, hingestreckt oder niedergestreckt weilen; gegenüber von sitzen, stehen und gehen:
2) liegen mit beisätzen, die eine art oder einen zustand anzeigen.
a) von menschen und thieren,
β) mit infinitiven:
der inf. durch zu vermittelt:
11) liegen, dann auch von anderem, dem man bildlich einen ort, eine lage, und mit dieser zusammenhängende beschaffenheit gibt; ebenfalls mehrfach, mit ursprünglich auf den ort weisenden beisätzen.
c) in etwas liegen, als eigenthümlich vorhanden oder beschlossen sein: dieser sinn liegt nicht in den worten; da in der anschauung etwas enthalten ist, was im begriffe nicht liegt. Kant 2, 270;
M top
- machen…のことである[GDJW]I 3(ausmachen)構成する:a)⦅数詞を目的語として⦆(…の)額に達する,(総計で…と)なる:b)意味する:7 d)⦅jn.⦆⦅zu のない不定詞〔句〕と⦆(…をいやおうなく…)させる:
sich machenにわかに〔すぐさま〕…にする[GDJW]7 c)⦅jn. 〈et.4〉 zu et.3⦆(…を…に)する,〔つくり〕変える;指名する,任命する:
[GRIMM]- machen, reflexiv.
- ) sich machen, als allgemeiner ausdruck für ein angreifen oder eine bewegung, die öfters an den begriff der eile rührt oder in ihn überstreif.
- ) mit präpositionen der richtung:
- ) sich machen, als allgemeiner ausdruck für ein angreifen oder eine bewegung, die öfters an den begriff der eile rührt oder in ihn überstreif.
- machen, reflexiv.
- mangeln[GDJW]I 1 a)非人称⦅es mangelt 〔jm.〕 an et.3 / ∇es mangelt 〔jm.〕 et.2⦆(〔…に〕…が)
欠けている,足りない,不足している: - manifestieren[GDJW]I 1 a)
明かに示す;(立場・態度などを)表明する,公表する,宣言する,声明する: - manumit [E][KNED]〈奴隷・農奴を〉
解放〈釈放〉する:〖⦅?a1425⦆▭OF manjmitter▭L manūmittere to release. ⦅原義⦆ to let out of one's hand↼manū by hand+mittere to send (off), dismiss: ⇨manual. mission〗 - mitgeben[GDJW]⦅jm. et.4⦆(去って行く人に)持たせてやる:mitgegeben 伴う
- mitleiden同情(ともに受苦)する[GDJW]同情する,(苦しみに)
共感する: - mitteilen伝導する[GDJW]1b)⦅雅⦆伝える:
- modifizieren[GDJW]1(部分的に)修正(変更)する,
制限する,やわらげる: - müssen[GDJW]1 b⦅否定詞 nicht, kein などとともに:→★⦆①⦅müssen の否定;アクセントが müssen にある⦆…しなければならないわけではない,…する必要はない:②⦅müssen ではなく不定詞の部分のみの否定;アクセントがその部分にある⦆2⦅話し手の推定を示して;普通定形でのみ用い,分詞や不定詞では用いない⦆a)…に違いない,きっと…であろう,…のはずだ:★ müssen の否定:i) 1の意味の用法では,否定はふつう müssen にかかる(…する必要はない,…するには及ばない)が,ときに否定が müssen 以外の部分にかかる場合(…しないようにする必要がある,…してはならない)がある.前者の意味には nicht brauchen を,後者の意味には nicht dürfen を用いるほうがふつうである.否定だけでなく nur, bloß と結びついた müssen (…しさえすればよい)も brauchen と対応する:ii) 2の用法(推定)では否定はふつう推定されている内容だけに関係するが,müssen だけが否定される用法もありうる:
- machen…のことである[GDJW]I 3(ausmachen)構成する:a)⦅数詞を目的語として⦆(…の)額に達する,(総計で…と)なる:b)意味する:7 d)⦅jn.⦆⦅zu のない不定詞〔句〕と⦆(…をいやおうなく…)させる:
N top
- nachsagen[GDJW]2(nachreden)⦅jm. et.4⦆(…について陰口めいたことを)言いふらす,悪口を言う:
- nachsehen[GDJW]II 1 a)調べてみる,
点検〈検査〉する: - nachstehen[GDJW]2⦅jm.⦆(…に)劣る,
ひけをとる,及ばない,(…の)後塵を拝する: - näherbringen[GDJW]⦅jm. et.4⦆(…に…を)いちだんと深く理解させる,なじませる:
- nehmen[GDJW]I 1 b)⦅方向を示す語句と⦆運ぶ,運び入れる〈出す〉,受け入れる,連れて〈持って〉行く:∇et.4 über sich4 ∼ …を引き受ける|7 a)⦅et.4⦆⦅様態を示す語句と⦆(…を…と)受け取る,
解する,考える:b)⦅et.4 für et.4 〈als et.4 〉⦆(…を…と)みなす,考える:c)⦅et.4⦆(…をある見方で)理解する,とらえる: [GRIMM]IV. mit sachlichem oder abstractem objecte: etwas nicht gegebenes nehmen, in verschiedener anwendung.
4) annehmen (von gestalt, wesen, ansehen und eigenschaft), mit persönlichem oder sachlichem subjecte (vergl. 5, a):
5) präpositionale verbindungen zu 1—4, die der übersichtlichkeit wegen hier besonders zusammengestellt werden:
h) über sich (vergl. auf sich) nehmen: eine last über sich nehmen, onus suscipere, subire. Frisch 1, 581c; gut! ich nehme alles über mich (zur verantwortung). Lessing 2, 475;
Vgl. annehmen - nennen[GDJW]1⦅jn. / et.4 のほかにさらに4格または様態を示す語句などを伴って⦆a)(…を…と)名づける,命名する,呼ぶ:c)(…であると)
言う, 称する: - niederdrücken抑えつける[GDJW]1
押し下げる;押えつける,(下へ)圧する: - niederlegen(後生大事に)引き下げる[GDJW]1⦅雅⦆a)
(下に)置く,横たえる:
[GRIMM]- ) transitiv, mit sächlichem und persönlichem subjecte, zum niederliegen, in den zustand der niederlage bringen.
- ) in bezug auf lebende wesen, in der älteren sprache.
- ) im kampfe überwältigen (durch tödtung oder gefangennahme), überhaupt eine niederlage beibringen, besiegen: sie wurden daselbs in die flucht geschlagen und nidergelegt. 1 Mos. 14, 10
- ) ...
- ) verwahrlich hinterlegen (bei, auf, in), deponere Stieler 1116. Zedler 23, 742. Frisch 1, 595c:
ein geheimer
verhaftsbefehl, den eure majestät
in meine hände niederlegt. 5, 2, 360 (don Carlos 4, 12)
- ) transitiv, mit sächlichem und persönlichem subjecte, zum niederliegen, in den zustand der niederlage bringen.
- nötigen[GDJW]1 a)⦅jn. zu et.3⦆(…に…を)
強いる,強要する,強制する,むりにさせる:(☞Nötigung) - nützen有用とする[GDJW]II他
役立てる,利用する:
O top
- obwalten普及する[GDJW]⦅現在・過去ではしばしば非分離⦆⦅雅⦆(現に)
存在する,現存する: [GRIMM]2) mit sachlichem subject, in bezug auf etwas walten (wirksam oder herrschend) vorhanden sein, vigere, imminere (im schwange gehen, verhanden sein).
- offenbaren明らかに啓いて示す[GDJW]2
明らかにする,知らせてしまう;〘宗〙啓示する:
- obwalten普及する[GDJW]⦅現在・過去ではしばしば非分離⦆⦅雅⦆(現に)
P top
- pflegen[GDJW]3⦅規則変化⦆⦅ふつう現在または過去時称で、zu不定詞(句)と⦆(…するのを)常としている,(…)習慣である:[GRIMM]
V. statt des infinitivs steht mhd., md. und frühnhd. bei pflegen (gewohnheit haben) auch ein nachsatz mit dasz:
- prädizieren述語を与える[GDJW]I 3〘論〙賓述する.
- produzieren[GDJW]1生産する,
産出する;製造する,製作(制作)する:(☞Produktion)
- pflegen[GDJW]3⦅規則変化⦆⦅ふつう現在または過去時称で、zu不定詞(句)と⦆(…するのを)常としている,(…)習慣である:[GRIMM]
Q top
- quälen[GDJW]I 1 a)⦅jn.(…にひどい)肉体的苦痛を与える,(肉体的に…を)苦しめる,痛めつける,責めさいなむ;(動物を)いじめる;
R top
- rächen復讐する[GDJW]1⦅jn. / et4⦆:
(…の)かたきを討つ,報復〈仕返し〉をする:2 a)再帰sich4 ∼ 復讐する,仕返しをする: - reden話題にする[GDJW]I(英:talk)⦅mit jm. über et.4〈von et.3〉⦆:(…と…について)話す,しゃべる,論じる,演説〈講演〉する:
[GRIM]
3) die bedeutung des verbums gründet sich auf den begriff des subst. rede, wie er seit der ahd. zeit sich ergeben hat (vgl. oben sp. 452, nr. 4) und bezieht sich daher auf jede geordnete auseinandersetzung und darlegung, die einer gibt, von vorn herein die mündliche, durch sagen oder sprechen, welches zu reden die vorstufe bildet:
denn auch von schriftlichen darlegungen in abhandlungen und briefen wird reden gebraucht, wobei jedoch die vorstellung des persönlichen sprechens immer im hintergrunde steht: sihe nu, ob nicht Daniel fast auf den schlag redet wie Isaias, von dem menschen son, der das ewige reich von gott empfehet, und wie Nathan und David reden. Luther 8, 147b; das ist (in der abhandlung) noch alles von dem text .. geredt, auf welchen, wie droben gesagt, sich die letzten wort Davids gründen. ebenda; ich ergreife die feder um wenige vertrauliche worte mit ihnen zu reden. A. v. Humboldt briefwechsel mit Varnhagen s. 77;
(☞Rede) - reduzieren[GDJW]2〘化〙還元する:3〘数〙簡約〈約分〉する:
- repelliren
repelliren et.2 von et.3(~が2~に(von))反発する[GDJW] Repellent[engl.; < lat. re-pellere „zurück-stoßen“ ...] (☞zurückstoßen) - respektieren[GDJW]1 a)⦅jn. / et4⦆尊敬する,(…に)敬意を抱く:b)⦅et4⦆尊重する,
正当なものと認める,顧慮〈配慮〉する: - reinigen[GDJW]1 a)
きれいにする,清める;清掃〈掃除〉する;洗う,すすぐ;〔ドライ〕クリーニングする;磨く;(液体などを)澄ます,浄化〈純化〉する;〘医〙消毒する:[GRIMM]2) freiere, übertragene anwendung.
a) von fremdartigem, irrthümlichem, störendem, feindseligem, gefährlichem befreien, in sehr mannigfaltiger anwendung:
- reißen[GDJW]I 2 d)⦅jn. / et.4⦆⦅方向を示す語句と⦆(…を…へ)〔強引に〕ひきよせる,ひき入れる,ひき上げる,拉し去る:jn. ⟨et.4⟩ mit sich3 ∼ / jn. ⟨et.4⟩ mit ∼ …を(自分と)一緒に引っぱって行く,…をさらって〈強引につれて〉行く|
- retten[GDJW]1救う,
救助する;救出〈救護〉する;無事に保つ,維持する:(ex.) Du bist mein rettender Engel. 君は私の救いの神だ| - richten[GDJW]I 1⦅方向を示す語句と⦆a)(…を…へ)向ける:einen Aufruf an jn. ∼ …に呼びかける;…向けのアピールを発する|seine Aufmerksamkeit auf et.4 …に注意を向ける| die Waffe auf ⟨gegen⟩ jn. ∼ …に武器を突きつける|b)再帰 sich4 an ⟨auf⟩ et.4 ∼ (呼びかけ・視線などが)…に向けられる,…のほうを向く,…をめざす:向き合う
- rühren[GDJW]4⦅jn.⦆感動させる;
(…の)心を動揺させる:
- rächen復讐する[GDJW]1⦅jn. / et4⦆:
S top
- schaffen[GDJW]I 1(新しいものを)
造り〈生み〉出す,創造する,創作する,創始〈創設〉する: - schärfen四つ裂きにする[GDJW]1 a)
(刃物を)研ぐ:[GRIMM]1) scharf machen, in bezug auf körperliches:
a) etwas an schneide und spitze scharf machen:
- scheiden[GDJW]I 2 a)⦅jn. 〈et.4〉 in et.4⦆(…を…に)分ける,区分する,区切る;⦅jn. 〈et.4〉 von jm. 〈et.4〉⦆(…を…と)区別する;選別する;より分ける:
再帰sich4 scheiden分かれる,区別される: (☞unterscheiden) - scheinen見かけを放つ[GDJW]1(英:shine)(光を発し・光を反映して)光る,輝く,照る;光って〈輝いて〉見える:
- schenken[GDJW]1 a)⦅jm. et.4⦆贈る,進呈する,プレゼントする:b)⦅jm. et.4⦆(広義で)与える:垂れる
[GRIMM]
4) schencken, donare, munerare, et munerari, dare dono Dasypodius; geben, begeben, schencken, verehren Henisch 1378, 28; diese bedeutung entwickelt sich erst gegen ende der mhd. zeit.
b) eine grosze reihe von redensarten und sprüchen der volksweisheit handelt vom schenken. man läszt sich gern etwas schenken, ist dankbar dafür, wenn es auch nicht eben von besonderem werte ist:
- schieben[GDJW]I 1 a)⦅et.4⦆押す;押して動かす;(ちょっと押して)ずらす :
- schießen[GDJW]I 1⦅ねらう目標を4格として⦆a)(英:shoot)(人・猟獣などを弓・武器などで)〔ねらい〕撃つ;仕留める,撃ち殺す:
- schlagen[GDJW]1 a)⦅jn. 〈et.4〉 〔mit et.3〕(…を〔…で〕被害を与えるために)打つ,たたく;殴る,ぶつ,ひっぱたく;
(…に)打ってかかる,切りつける;⦅俗⦆(…を)殴り殺す;∇殺す;〘狩〙(野獣が獲物を)襲う,〔打ち・たたき〕殺す: - schleifen2[GDJW]I 1(schleppen)引きずる,引っぱってゆく;⦅話⦆無理に連れてゆく:
- schließen[GDJW]I 2 a) ②et.4 in sich4 ~ (…を内部に)
含む,含有する,はらむ,ともなう: - schwärmen[GDJW]3熱狂する,
熱中する,夢中になる,熱愛する,心酔する;夢中になって〈感激して〉話す,熱烈に崇拝する: - sehen[GDJW]I 2⦅精神的知覚⦆a)⦅しばしば daß 副文・間接疑問文などと⦆見てとる,
悟る,見抜く,(…に)気づく,(…であることが)分かる:〖in et.3 et.4 sehen などの形で】(ex.) Er sieht in diesem Mann nur den Gegner. 彼はその男を反対者〈敵〉としか見ていない| - sein[GDJW]I(英:be)⦅存在を示して⦆1c)(existieren)存在する:Es ist kein Zweifel mehr. もはや疑う余地はない|e)⦅話⦆(gehören)(jm.)(…の)所有物である,(…の)ものである:★ es gibt と es ist の違い:es ist が基本的には「現実としての存在」を表すのに対して,es gibt はより広く「可能性としての存在」を表す;したがってまた,es gibt は特に「ある空間における本来的・恒常的存在」を表すのに用いられる:Es gibt Forellen in diesem Bach. この小川には鱒が〔生息して〕いる(現実に目撃したかどうかは別とし,本来の可能性からいうと).2 a)⦅素性・由来・出所・所属などを表す⦆…から〔の〕,…出身〔の〕,…所属〔の〕:e)⦅2格の名詞と⦆①(…の)属性をもつ;②⦅雅⦆(…〔の領分〕に)属する,(…の)支配下にある:3⦅前置詞と⦆b)⦅aus または von と;材料・由来・属性を示して⦆…のものである:
[GRIMM]
II. bedeutung.
2) sein als selbständiges vollverb.
a) schlechthin, um die existenz eines dinges zu behaupten:
im allgemeinen jedoch sagt man in der umgangssprache lieber da sein, existieren oder es giebt.
3) häufig dient sein nicht, um die existenz eines dinges schlechthin auszusagen, sondern innerhalb gewisser, ausgesprochener oder aus dem zusammenhange sich ergebender einschränkungen. hier pflegen wir jetzt meistens es giebt zu gebrauchen.
- setzen[GDJW]7⦅jm. 〈et.3〉 et4⦆(…を…に)設定する,
定める: - seufzen嘆息する[GDJW]Iため息をつく,ほっと息をつく,うめく:(ex.) über et.4 ~ …を嘆く
- sollicitiren誘い出す[DAF]
SOLLICITER. v. a. Inciter, exciter à faire quelque chose.
(☞Sollicitation) - sorgen[GDJW]I 1⦅für jn. ⟨et.4⟩⦆(…のために,…のことを)配慮する,心配する,気づかう;(…の)世話をする,面倒を見る:
- sprechen[GDJW]I 1⦅人を主語として⦆a)(英:speak)話す,ものを言う,しゃべる,口をきく,口に出す:b)意見を述べる,弁じる;(…について)話す,話をする,物語る:über jn. ⟨et.4⟩ ∼ / von jm. ⟨et.3⟩ ∼ …について話す〈報告する〉,…を話題にする|d)⦅von et.3⦆(…を)口にする,(…という)言葉を用いる:
- statt finden[GDJW](行事・集会などが)〔とり〕行われる,開催される;(事件が)起こる:
- statt haben当っている
[GRIMM] statt
II. bedeutung und gebrauch.
C. im nhd. ist statt hauptsächlich in einigen formelhaften verbindungen erhalten, wo eine scheidung dieser beiden wörter nicht mehr durchführbar ist.
1) statt haben.
d) die wichtigsten gebrauchsweisen im einzelnen, die z. th. ebenfalls auf die ältere sprache beschränkt sind.
δ) in neuerer sprache gewöhnlich mit angaben über thatsächliches, zuständliches, die damit als zutreffend, wirklich vorhanden, richtig, geltung habend und ähnlich bezeichnet werden sollen; am häufigsten neben negationen: so schon im 16. jahrh.:
- stecken[GDJW]I 1⦅jn. / et.4⦆(…を…へ)差す,差し〈はめ〉こむ,はめる,突っこむ:
- stehen[GDJW]2(↔gehen)(先に進まずにある場所に)とどまっている,停滞している:2 g)(指針などが一点を)指して〔止まって〕いる,(…の方向を)向いている: Der Zeiger steht auf zwölf. 指針は 12 を示している|
位置づけられる:5⦅本来の意味が薄れて sein に近い機能で⦆b) ①⦅場所を示す語句と⦆(…に)ある,(…に)位置する,(…に)現れる,置かれる: - stehenbleiben[GDJW]1 a)⦅方向を示す語句と⦆立ち止ま〔ってい〕る;〘比〙(成長などが)止ま〔ってい〕る:2b)①消滅せずに残っている:
[GRIMM]II. ... E) einige feste verbindungen verlangen besondere betrachtung.
3) sonst geht stehen mit andern verben feste verbindungen ein, die éinen begriff bilden. so zunächst stehen bleiben, das im allgemeinen mit still stehen gleichbedeutend, nur noch entschiedener perfectiv ist.
c) daran schlieszen freiere gebrauchsweisen.
γ) sehr gewöhnlich bei etwas stehen bleiben:
so bes. in bezug auf gespräche, rede, schriftstellerische darstellung u. dergl.; bei einem gegenstande verweilen: ich will vors erste bey einer kleinigkeit stehen bleiben Lessing 6, 18 (lit. br. 1, 9);
'auch wird stehen bleiben im gemeinen leben für nicht weiter fortkönnen gebraucht. mitten in seiner rede, predigt etc. blieb er stehen'
η) von menschen auf ihre werke u. ähnl. übertragen:
考え続ける - stehlen[GDJW]1(英:steal)⦅jm. et.4⦆(…から…を)盗む,くすねる,横取りする,奪う:
- steigern[GDJW]I 1⦅et.4⦆(…の程度を)高める,
上げる,増す,増強する:2再帰sich4 ∼ (程度・度合が)高まる,上がる,増大する: - stellen[GDJW]I 1⦅方向を示す語句と⦆b)再帰sich4 ∼ (…へ)立つ,身を置く:sich4 auf die Waage ⟨die Leiter⟩ ∼ 台ばかり〈はしご〉に乗る|sich4 auf einen Standpunkt ∼ ⦅比⦆ある立場に立つ|Stell dich neben mich! 私と並びなさい|
- stoßen突きとめる[GDJW]II 5⦅auf et.4⦆ (偶然に…に)ぶつかる;出くわす,遭遇する;逢着する:
- strafen[GDJW]I 1⦅jn.⦆罰する,処罰する;
責める,叱責する,非難する:(☞bestrafen) - streiten[GDJW]I 自 1争う,
けんか〈いさかい〉をする,抗争〈衝突〉する: - stören[GDJW]1⦅jn.⦆(…の)邪魔をする:
- stürmen[GDJW]2⦅方向を示す語句と⦆
あらしが過ぎていく;〘軍〙突撃する;⦅比⦆突進する: - subsistieren実体化する[GDJW]〘哲〙(他者から独立して・時間空間を超越して)
存在する,自存する: [GRIMM]subsistieren, vb., nach lat. subsistere seit dem 17. jh. bezeugte bildung.
3)in philos. verstande, entsprechend lat. substantia s. o.: (von den engeln unterscheidet Thomas von Aquino) die intellektuellen substanzen oder unkörperlichen subsistirenden formen, welche ... der körper bedürfen Dilthey einl. in d. geisteswiss. (1883) 1, 8.
- subsumieren[GDJW]⦅et.4 et.3 / et.4 unter et.4 〈et.3〉⦆(…をより包括的な概念・命題・条項などのなかへ)
包含する,包摂する: - suchen[GDJW]I 1(英:seek)探す,探し求める,見つけ出そうと〈手に入れようと〉する;探索〈捜索・捜査〉する;求める,追求〈探求〉する;〘電算〙検索する :
- schaffen[GDJW]I 1(新しいものを)
T top
- täuschen[GDJW]I 1 a)だます,欺く,惑わす;失望させる,裏切る:
- teilen[GDJW]1 a)⦅全体を2個または数個の部分に⦆分ける,分割する,区分する:||再帰 sich4 ∼ 分かれる;
⦅道などが⦆分岐する;⦅細胞などが⦆分裂する| - thun[GDJW]I 1 a)⦅主に人を主語として⦆…‖〖zu 不定詞で〗jm. ist 〔es〕 um jn. 〈et.4〉 zu ∼ …にとっては…が問題〈重要〉である|2⦅方向を示す語句と⦆(…を…に)入れる,入れこむ,はこぶ,加える,置く,はめる,つける,する:
[GRIMM]
IV. thun mit fortlassung eines objectes (auszer den schon bei II und III vorkommenden fällen). vgl. DWB machen III.
1) in irgend etwas thätig oder wirksam sein, handeln, verfahren, sich verhalten (thun heiszt nach seiner überzeugung handeln. Hippel 4, 172).
c)thun als:
はたらく(thun und〔auch〕 lassen ☞lassen) - töten殺害する[GDJW]1(英:kill)a)⦅jn.⦆殺す,死なせる:
- tragen[GDJW]I 1 a)支える,
載(せて)いる;持ちこたえる,持ち上げていられる;⦅比⦆支持する:I 5 a)(樹木・耕地などが実りを)もたらす,(実を)つける,生じる;⦅比⦆(利益・収益を)生む: - treffen[GDJW]:
[GRIMM]
'berühren, erreichen, begegnen'.
I. etwas durch schlag, stosz, stich, wurf oder schusz richtig berühren.
B. die speziell deutsche bedeutung, in der treffen nicht das schlagen, stoszen u. s. w. überhaupt, sondern das auf die richtige, meist gewünschte stelle treffen bezeichnet, ist schon seit ahd. zeit bezeugt.
II. übertragung auf nicht oder weniger materielle vorgänge. die subjecte des treffens sind unpersönlich.
A. 'jemanden oder etwas schädigend erreichen, berühren'.
D. 'den menschen innerlich berühren, auf sein inneres wirken'.
1) jemanden, meist übelwollend, mit etwas meinen, ihn innerlich verletzen.
b) meistens ist 'verwunden, verletzen' mit 'meinen, betreffen, anlangen' fest verbunden; auch ist 'richtig treffen, auffinden', fast schon im sinne von III, beteiligt. häufig in causaler verknüpfung: jemanden meinend an der richtigen stelle anlangen und ihm dadurch eins versetzen, ihn verletzen:
unzweifelhaft trifft der vorliegende fall, soweit er diese natur hat, mehr mich als meine collegen. die letzteren sind ... nicht in dem masze wie ich öffentlich verletzt worden Bismarck ged. u. erinn. 2, 230 volksausg.
III. etwas mit den geistigen kräften erreichen, erzielen, lösen, bewirken. im gegensatz zu I B und weiten bereichen von II (besonders A und D) fehlt jede beeinfluszung und veränderung des objectes durch das treffen, insbesondere kann hier das treffen nie auf den menschen gerichtet sein (vgl. dagegen II D).
- treiben[GDJW]I 2 a)⦅et.4⦆(物理的強制力で〔自分の前を〕一定の方向・場所へ)
移動させる,押して動かす,追いやる,駆り立てる;(風などが…を)吹き付け〈寄せ〉る;(潮流などが…を)押し流す;〘球技〙(ボールを)けりながら進む,ドリブルする: - trennen[GDJW]I 1⦅et.4 von 〈aus〉 et.3⦆(…を…から)
引き〈切り〉離す,分離する;遠ざける,隔離する;切りとる;はずす;切りほどく;分ける;区別する: - treten[GDJW]I 1 a)⦅方向を示す語句と⦆(…へ向かって)歩む,(…から)歩み出る;(一般に)移動する,進む,出る,入る: 2 a)⦅方向を示す語句と⦆(…に)
足を踏み入れる;(無意識に・うっかり)踏む、踏み込む,踏みつける;つまずく:(☞auftreten, ☞eintreten, ☞gegenübertreten, ☞heraustreten, ☞hervortreten, ☞hintreten, ☞hinzutreten)
U top
- über|füren移送[GDJW]2⦅et.4 in et.4⦆(…を…に)
移行させる,変える,転換する: - über|gehen移行する[GDJW]1 a)(向こう側に)移る,
変わる:2⦅zu et.3⦆(あることをやめて他のことに)移る,移行する;〘楽〙推移する,(一時的に)転調する:3⦅in et.4⦆(他の状態に)〔しだいに〕変わる,移行する:4⦅in et.4 / auf jn.⦆(所有が)移る,受け継がれる:移転する - über|greifen[GDJW]I 2⦅in et.4⦆(…に自分の権限を逸脱して)干渉する:
- übergreifen
[GRIMM]
2) über etwas hinausgreifen, in bildlicher und abgezogener bedeutung: fehlgreifen, übertreten, auszer acht lassen.
上回る - überlassen[GDJW]1 a)⦅jm. et.4⦆(…に…を)任せる,ゆだねる,委託する;貸す,与える,引き渡す,
譲渡する;〘商〙売る:b)⦅jn. et.3⦆(…を…に)任せる,ゆだねる:(ex.)再帰 sich4 et.3 ∼…に身を任せる〈ふける〉|…に身をゆだねる - überreden[GDJW]2⦅jn. zu et.3⦆(…に…するよう)
説得する,説き伏せる,くどく: - überschreiten[GDJW]1(歩いて)超える:
- übersehen[GDJW]2⦅et.4 / jn.⦆
(うっかりして)見落とす,(…に)気づかない,見のがす;(故意に)見ない,見のがす,大目に見る,無視する: - über|setzen向こうに設定する[GDJW]I 2向こうへ(越えて・またいで)置く:
- übersetzen[GDJW]I b)⦅et.4 in et.4⦆
移す,変形する,直す: - übertreten[GDJW]I b)⦅in et.4⦆(…に)
入りこむ,侵入する: - überweisen[GRIMM]
überweisen, v. überzeugen, überführen, beweisen, anweisen, zutheilen.
A. die abgezogene bedeutung (überzeugen, überführen) dominiert, besonders in der älteren spr.; stets untrennb. verwendet.
1) jemanden ü., überzeugen, von allen wbb. seit dem 16. jahrh. gebucht: convincere, revincere, arguere, coarguere, s. [...] Hulsius (1605) 144a und Kramer (1702) 2, 1307a verweisen unter überweisen auf die artikel 'überzeugen', neuere wbb. versuchen zu scheiden: wenn ein anderer das daseyn eines dinges nicht glauben will und man weiset oder zeiget ihm solches, so überweiset man ihn. durch diesen umstand des augenscheins unterscheidet sich überweisen von überzeugen und überführen, obgleich alle drey häufig füreinander gebraucht werden Adelung 4, 783; ähnlich Heynatz antibarb. (1796) 2, 497; Eberhard synon. (1795—1802) 6, 183. heute nicht mehr üblich.
2) verengt was überführen: überweisen scheint ... vorauszusetzen, dasz derjenige, den man ... zur erkenntnis einer wahrheit bringt, vorher diese wahrheit geleugnet ... hat allgem. dtsche bibl. 20, 222; mit gründen widerlegen, überführen, s. Crecelius und den beleg dort.
3) als term. der rechtsspr. (im streitverfahren) jem. ü., überführen.
自供させる - überwiegen[GDJW]I⦅et.4⦆
(…より)重い目方がある;(…より)多数〈優勢〉である,重要である,優位を占めている;凌駕する,負かす,おさえる,圧倒する: - überwinden[GDJW]I 1⦅et.4 / jn.⦆(…に)
打ち勝つ;克服する,乗り越える,過去のものにしてしまう: - übriglassen[GDJW]残す,余す;残して〈余して〉置く:
- übrigbleiben[GDJW]残って(余って)いる:
- umbiegen捻じ曲げる[GDJW]I曲げる;⦅比⦆ゆがめる,歪曲する:
- umbringen[GDJW]2再帰sich4~ 自殺する:
- umgehen[GDJW]2他⦅比⦆
回避する,避け〔て通〕る;(法律などを)すり抜ける: - umkehren反転する[GDJW]I自回れ右する,引き返す;⦅比⦆改心する,行状を改める:II他1⦅et.4⦆(…の)向きを反対にする,反対向きにする;ひっくり返す:2再帰sich4 ∼ くるりと向きを変える,振り向く:3正反対のものに変える,あべこべにする:et.4 in et.4 ∼ …を(それとは正反対の)…に変える‖再帰sich4 ∼ あべこべになる|(☞ Umkehrung)
- umschlagen[GDJW]I 2
(風向き・天候・気分などが)急激に変わる,急変〈激変〉する;(正反対のものの)転化〈転換〉する: - umschließen包含する[GDJW]1取り巻く(囲む),包み込む;⦅軍⦆包囲する;⦅比⦆含む,算入する,勘定に入れる:(☞ befassen)
- umsetzen[GDJW]2 a)⦅et.4 in et.4⦆(…を…〔の形・状態〕に)
変える,変換〈転換〉する,転化する;言いかえる,翻訳する: - umwerben[GDJW]⦅jn.⦆(…に)求愛する,言い寄る;⦅比⦆(…に)気に入られようと努力する.
- unterdrücken[GDJW]1(心的活動・感情などを)抑える,
抑制する;(笑い・あくび・叫びなどを)こらえる,我慢する: - untergehen没して行く[GDJW]2(水中に)
没する,(船などが)沈没する;⦅比⦆没落する,破滅〈滅亡〉する;零落する,落ちぶれる;堕落する: - unterlassen[GDJW]I 1(行為・習慣・企図・計画などを)やめる,よす;慎む,控える;(なすべきことを)しない、怠る:
- unter|legen[GDJW]⦅jm. <et.3> et.4⦆(…を…の)下に置く,敷く,下に押し入れる:(☞ Substrat)
- unterliegen配下にある[GDJW]I 1⦅jm.⦆(…に)屈〔服〕する,
(…に)負ける,敗れる:2⦅et.3⦆(…の)支配〈影響〉下にある;(…を)義務づけられている,(…を)免れない;(…を)必要とする,(…を)受ける: - unterordnen下位区分する[GDJW]I 1⦅jn. jm. et.3〉 / et.4 jm.〈et.3〉⦆(…を…の)下位に置く,(…を…に)
従属させる:再帰sich4 jn. ∼ …に従う,…に順応する:…に従属する - unterscheiden[GDJW]I 1区別する,
類別する,識別〈判別;弁別〉する,見〈聞き〉分ける:2再帰sich4 von et.3〔in et.3 / durch et.4〕 ∼ …と〔…の点で〕区別される〔区別がつく〕:(☞scheiden)
[GRIMM](☞unterschied, unterscheiden)- wesentlich abstract. die gedankliche unterscheidung geht wieder von der sinnlichen (1) aus und gipfelt in der begrifflichen (4). bedeutungsentwicklungen der ä. spr. (5—7) sind von der n. spr. aufgegeben.
- ) von begrifflicher unterscheidung im engern sinne.
- ) etwas als in seiner art, von andern gesondert, für sich bestehend, anerkennen:
- ) prägnant unterschiede machen, verschiedenheiten anerkennen:
- ) man kann in ein und derselben person oder ein und demselben gegenstande zwei eigenschaften gesondert betrachten:
- ) den charakteristischen unterschied ausmachen, das unterscheidungsmerkmal bilden:
- ) sich u., früher auch einfaches u.:
- ) von begrifflicher unterscheidung im engern sinne.
- wesentlich abstract. die gedankliche unterscheidung geht wieder von der sinnlichen (1) aus und gipfelt in der begrifflichen (4). bedeutungsentwicklungen der ä. spr. (5—7) sind von der n. spr. aufgegeben.
- unterstützung[GDJW]1⦅jn. / et.4⦆支持する,
支援〈後援〉する;援助する,扶助する;(…に)補助〈助成〉金を出す;〘法〙幇助する: - unterwerfen[GDJW]1 a)⦅jn.⦆
征服する,屈伏〈隷属〉させる;従わせる:b)再帰sich4~ 屈伏〈降伏〉する:(ex.)sich4 jm.〈et.3〉~ …に屈する,…に服する,…に従う|
- über|füren移送[GDJW]2⦅et.4 in et.4⦆(…を…に)
V top
- ver..[GDJW]⦅非分離動詞の前つづりで、意味上 er.., zer.. と競合することがある.つねにアクセントを持たない⦆ 1 a)⦅「代理」を意味するもの⦆: verantworten 責任を負う|b)⦅「時間的限度の超過」を意味する⦆: versäumen (物事を)しそこなう.c)⦅「場所の変更」を意味する⦆: verpflanzen 移植する|versetzen 移す.d)⦅「閉鎖・阻止」を意味する⦆: verstecken 隠す.e)⦅「消滅」を意味する⦆: verfließen 流れ去る|f)⦅「除去・破壊・消費・浪費」を意味する⦆: verbannen 追放する|verzehren 食い〈飲み〉つくす|verbrauchen 消費する|g)⦅「歪曲・失策・逆の行為」を意味する⦆: verachten 軽蔑する|h)⦅強意⦆versinken 沈む.i)⦅その他⦆➀⦅もとの動詞と意味の違うもの⦆: verdienen 〈働いて〉得る|verfolgen 迫害する|verstehen 理解する.②⦅もとの動詞が消滅したもの⦆: verderben だめにする|vergessen 忘れる|verlieren 失う. [idg.: ◇per1, pro, vor, fern]
- verachten[GDJW](↔achten)軽蔑する,侮蔑する,侮る,さげすむ,軽んじる,軽視する,見くびる:
- veränderen[GDJW]1
変える,変化させる;再帰sich4~変わる,変化する: - veranschlagen[GDJW](数量,特に経費などを)あらかじめ計算する,見積もる;⦅比⦆評価する:
- veranstalten[GDJW]1(会合・行事などを)
催す,とり行う,開催する;(企画を)実施する:[GRIMM]meist liegt in veranstalten der nebenbegriff des umständlicheren vorbereitens, ins werk setzens einer sache:
den sinn des umständlichen herrichtens wahrend, aber auf dinge übertragen, die sonst mühelos geschehen und daher scherzhaft wirkend:
- verarbeiten[GDJW]I1a)(原料を)加工する;⦅et.4 zu et.3⦆(…に)手を加えて(…を)作る:
- veräußern[GDJW]
売る,売却〈処分〉する;(権利などを)譲渡する:(☞entäußern) [GRIMM]verb. alienare, ahd. nicht nachgewiesen, mhd. veriuʒern, verûʒern, mnd. vorûteren, nnd. verütern (brem. wb. 5, 157), nhd. vereuszern, veräuszern. das einfache äuszern, hinausthun, hinausschaffen, wird durch ver verstärkt. veräuszern, weit hinausthun, sich einer sache für immer begeben (Weigand synon. 1, 353). im nhd. veräuszern vorwiegend für 'in fremden besitz bringen, verkaufen' von concreten dingen, äuszern für abstracte bedeutung gebraucht;
2) hinausgeben, fortgeben, in anderen besitz bringen:
nhd. vereuseren, alienare, commutare, distrahere Stieler 71; veräuszern, vendere Frisch 1, 43;
- verbannen[GDJW]⦅jn.⦆⦅方向を示す語句と⦆(…を国外などに)追放する,
放逐する,流罪(流刑)に処する;(一般に団体・グループなどから)締め出す,除名する;⦅et.4⦆(考え・気分などを)追いはらう: - verbergen[GDJW]I1隠す,
隠し〔持っ〕ている,隠匿する;秘密にする,秘匿する: - verbinden[GDJW]2a)⦅et.4〔mit et.3〕⦆(…を〔…と〕)
結び合わせる,結合する,連結〈接合〉する: - verbrauchen[GDJW]1 a)消費する,(電気・水道・ガスなどを)
使用する: - verdammen[GDJW]I 1⦅jn. / et.4⦆(不当であるとして)
弾劾する,間違いであると決めつける,非難する: - verdienen[GDJW]2⦅et.4⦆(報酬・賞賛・罰・非難などを)
受けるにふさわしい,(…に)値する: - verdunkeln[GDJW]I1暗くする;(輝きなどを)曇らせる;(色彩を)濃くする,黒ずませる;(光が外部に漏れないように)遮光する:2 不明瞭
〈あいまい〉にする;(事実を)隠蔽する,隠匿する. - vereheren崇める[GDJW]1⦅jn.⦆尊敬する,崇拝〈敬慕〉する;
(…に)思いを寄せる: - vereinen合一する[GDJW]1(合わせて)一つにする,
一つにまとめる〈結合させる〉,一体化する;合併する,合同させる: - vereinigen統一化する
合一する[GDJW]1一つにまとめる〈結合させる〉,一体化する;合併する,合同させる:(☞Vereinigung) - vereinzeln[GDJW]1個別化する,
別々〈ばらばらに〉する. - verfahren道に外れる[GDJW]II 1再帰sich4 ∼
(乗り物で・乗り物が)道を間違える,道に迷う: - verfallen[GDJW]
3⦅auf et.4⦆
(…を)思いつく:考えつく 4⦅in et.4⦆(…の状態に)陥る: 5⦅jm. / et.3⦆⦅比⦆(…の)とりこになる: - verfehlen取り損なう[GDJW]1⦅et.4⦆(的を)外す,(目標に)当てそこなう;(事物を)やりそこなう,仕損じる;誤る,間違える:
- verfließen[GDJW]1(時間が)
流れ去る,経過する: - verfolgen追究する[GDJW]4⦅et.4⦆(道を)
どこまでもたどる,(目的・計画・政策などを)追及する:(☞folgen) [GRIMM]verfolgen, verb. nachfolgen, zu erreichen suchen, mhd. vervolgen, mnd. vervolgen, alts. farfolgôn, altfr. urfolgia, forfolgia. zusammensetzung mit folgen (theil 3, 1875), dessen bedeutung ver verstärkt, dessen construction es ändert, indem folgen höchst selten transitiv (s. th. 3, 1878, 8), verfolgen aber überwiegend transitiv steht.
4) durchaus abstract, sich mit etwas befassen.
b) mit der nebenbedeutung 'um etwas zu erforschen, genau kennen zu lernen': ich bleibe also stehen, verfolge den faden seiner gedanken zurück, ponderire ein jedes wort. Lessing 7, 170; er (dieser satz) ist ein logisches postulat der vernunft: diejenige verknüpfung eines begriffs mit seinen bedingungen durch den verstand zu verfolgen. Kant 2, 394;
- vergehen[GDJW]I 2
消え去る,消滅する;(気分・感情・生理的状態などが)消えうせる,なくなる: - vergessen[GDJW]I 1(英:forget)a)⦅et.4⦆(…〔のこと〕を)忘れる,失念〈忘却〉する;(うっかり…するのを)忘れる,怠る:
- vergewissern納得する[GDJW]1sich4et.2〈über et.4〉~
…を確かめる,…を確認する| [GRIMM]verb. sicher machen, verbalbildung aus dem comparativ von gewiss. erst seit dem 17. jahrh. häufiger nachweisbar, doch alsbald das ältere vergewissen gänzlich verdrängend. Lexer 3, 113 führt ein mhd. vergewissern an:- ) mit persönlichem accusativ, die sache, über die man gewissheit erlangt, im genitiv oder durch einen abhängigen satz beigefügt:
- ) reflexiv, sache, worauf sich das vergewissern bezieht, im genitiv:
- ) selten steht vergewissern mit sächlichem objecte, klar stellen:
- vergleichen[GDJW]1⦅jn. 〈et.4〉 mit jm.〈et.4〉⦆〈(…を…と)比べる,比較する;対比する,照合〈校合〉する;(…を…に)比する,たとえる:
[GRIMM]相等である- ) sonst wird vergleichen durchweg transitiv gebraucht, die ursprüngliche bedeutung 'gleich machen' finden wir
- ) auf äuszeres ansehen angewandt (vom ebnen, ausgleichen der bodenerhebungen und senkungen):
- ) auf geistiges bildlich übertragen:
- ) abstract, geistig gleichmachen, d. i. zur übereinstimmung bringen.
- ) mit persönlichem objecte:
- ) mit sächlichem objecte, ohne nähere bestimmung, ausgleichen, gleichmäszig machen, zur übereinstimmung bringen:
- ) reflexivum, im anschlusse an a, von menschen gesagt, zur übereinstimmenden handlung, ansicht kommen:
- ) sonst wird vergleichen durchweg transitiv gebraucht, die ursprüngliche bedeutung 'gleich machen' finden wir
- vergnügen楽しむ
verb. befriedigen, erfreuen.
3) den übergang zur construction mit sachlichem objecte bilden die zusammenstellungen von vergnügen mit abstracten begriffen. dieselben fassen wir dann als mehr oder weniger persönlich genommen auf. diese redeweise, welche einer gewählteren sprache angehört, ist erst in neuerer zeit geläufig:
- verhalten関わる[GDJW]
I 1 a)再帰sich4 ∼ ⦅様態を示す語句と⦆…の態度〈行動〉をとる,(…のように)振舞う:
2再帰sich4 ∼ ⦅様態を示す語句と⦆
(…のような)状態〈状況〉である,事情は(…)である| 再帰・非人称Mit der Sache verhält es sich folgendermaßen 〈ganz anders〉. この件については事情は次のとおり〈全く別〉である.事態 3⦅sich4 zu et.3 wie ...⦆…に対して…の〔比例〕関係にある: [GRIMM]zurückhalten, an einem orte, in einer thätigkeit halten, mhd. verhalten, nd. nl. nicht nachgewiesen, ahd. farhaltan, ags. forhealdan, schwed. förhålla, dän. forholde. das zeitwort im mhd. und nhd. nur in starker form nachgewiesen. verhalten ist zusammensetzung mit halten, dessen bedeutung ver nicht wesentlich ändert, sondern nur verstärkt, und ist ursprünglich festhalten, dann fernhalten, durch festhalten beseitigen. aus dieser bedeutung entwickelt sich 'zurückhalten, verbergen' (abstract 'verschweigen'), und weil das zurückgehaltene oft dasjenige ist, was nicht werth ist an das tageslicht zu kommen 'verachten'. hierher stellen wir ags. forhealdan, detinere, negligere, contemnere. zu dieser bedeutung oder zu der von 'verbergen' stellt sich ags. forhealden, polluted, incestus (Bosworth - Toller 1, 312) und ahd. farhaltaniu, prostituta (Steinmeyer-Sievers 1, 231), farhaltani, incestum 1, 91, 5. daneben steht eine zweite entwicklung der bedeutung, in der ver mehr zurücktritt und verhalten ähnlich dem einfachen halten sich entwickelt: einen verhalten, einen festhalten, einem aufenthalt geben, einer sache stellung geben, hieraus besonders das heute weitverbreitete sich verhalten, vgl. th. 42, 278.
10) aus der sinnlichen bedeutung 'aufenthalt, herberge geben', sich verhalten sich aufhalten, entwickelt sich die abstracte verhalten, in einen zustand bringen (ein transitiv, das nur im reflexiv nachgewiesen ist), sich verhalten, sich in einem zustande befinden, sich betragen; sehr selten ohne adverbialen oder sonstigen die art des verhaltens bestimmenden zusatz:
meist ist das verhalten durch zusätze irgend welcher art näher bestimmt:
etwas verhält sich zu einer sache: wie pantomime zur erhabensten poesie sich verhalten würde. Lessing 8, 13; die künste sind das salz der erde; wie dieses zu den speisen, so verhalten sich jene zu der technik. Göthe 22, 149;
- verhüllen[GDJW]
覆う,包む;覆い隠す,包み隠す: - verkehren顚倒させる[GDJW]II⦅et.4 in et.4⦆(…をその正反対の…に)
変える,逆さにする:(☞Verkehrung) - verkennen[GDJW]
見誤る,見そこなう,誤認〈誤解〉する,(…についての)判断を誤る: - verknüpfen[GDJW]I 1⦅et.4 mit et.3⦆(…を…と)結びつける,
結び合わせる: - verlangen[GDJW]I 1⦅〔von jm.〕 et.4⦆(人が〔…に〕…を)求める,
要求する,請求する: - verlaufen[GDJW]I他(h)2 a)再帰sich4 ∼ (群衆などが)散らばる,四散する:散り散りばらばらになるb)再帰sich4 ∼ (水が)ひく,吸い込まれる:II 2自(s)⦅様態を示す語句と⦆(時が)過ぎ行く;経過する,
推移する,進行する;(…の)結果に終わる: - verlegen移動する[GDJW]1⦅方向を示す語句と⦆a)⦅jn./et.4⦆(…を…へ)場所を移す,
移転する: - verletzen侵害する[GDJW]2 b)(境界・おきて・社会的通念などに)そむく,違反する:(ex.) das Briefgeheimnis ∼ 信書の秘密を侵害する| das Gesetz ∼ 法を犯す| Seine Rechte wurden verletzt. 彼の権利が侵害された.(☞Verletzung)
- verlieren[GDJW]I他1 a)(大切なものを)失う,
なくす,喪失する;見失う,紛失する,落とす:3 b)sich4~⦅場所を示す語句と⦆(〔しだいに遠ざかって〕…の中に)姿を消す,見えなくなる: - vermischen[GDJW]I 1⦅et.4 mit et.3⦆(…を…と)混ぜ〔合わせ〕る,混合する :2⦅et.4 mit et.3⦆(…を…と)
ごちゃまぜにする,混同する: - vermuten言い分を通す[GDJW]I 1(…と)推測〈推察・推定〉する,
想像する;予想する:(☞Vermutung) [GRIMM]3) verschiedene beliebte zusammenstellungen, vermuten dasz:
- vernichten[GDJW]滅ぼす,破壊しつくす,根絶〈絶滅〉する;(希望・計画などを)無に帰せしめる:(文書などを)破棄する,処分〈焼却〉する:
- verpflanzen[GDJW]1⦅et.4⦆a)(植物を)
移し植える,移植する: - verpflichten[GDJW]⦅jn.〔zu et.3〕⦆(…に〔…の〕)義務を負わせる、(…に〔を〕)義務づける;
(俳優・歌手・スポーツ選手などを)契約によって縛る〈義務づける〉(☞Verpflichtung) - verraten[GDJW]2 b)再帰sich4~ 正体が露見する,
お里が知れる: - versäumen[GDJW]1(機会などを)のがす,逸する,失する;(物事を)しそこなう;(定刻・期日などに)遅れる;(なすべきことなどを)怠る,なおざりにする,欠席する,さぼる;(時間を)空費する:
- verschließen[GDJW]2⦅et.4〔in et.3〕⦆(…を〔…の中に〕)しまい込む
(鍵を掛けて),閉じ込める,保管する;⦅比⦆秘める,隠す: - verschwinden[GDJW]I㉂(s)
見えなくなる,(視界から)消える,姿を消す;なくなる,いなくなる;消滅する;⦅話⦆便所に行く: - versenken[GDJW]1
(下方に)落とす,降ろす,下降させる:(表面下に)沈める,沈没〈埋没〉させる: - versetzen[GDJW]1 a)⦅et.4⦆(…を)
他の場所へ移す,移動させる,移し替える,置き換える:2⦅jn.〈et.4〉 in et.4⦆(…を…の状態・状況・立場に)置く,陥らせる: - versichern[GDJW]1 a)⦅〔jm.〕 et.4⦆(〔…に〕…を)請け合う,保証する,
確言(断言)する: - versorgen[GDJW]I 1 a)⦅jn. / et.4⦆(…の)世話をする,
面倒を見る;責任をもって管理〈処理〉する: - versprechen[GDJW]I 1 a)⦅jm. et.4⦆(…に…を)約束する;
(…に…することを)誓う:2 a)⦅et.4⦆(…を)期待させる,(…の)望み〈おそれ〉を抱かせる - verstecken[GDJW]I⦅jn. / et.4⦆隠す,
隠匿〈秘匿〉する: [GRIMM]1) es geht in der bedeutung auf das trans. 1stecken (th. 10, 2, 1298) als factitivum zu stechen zurück, hat aber auch die ausläufer des intrans. (ebd. 1319), einer durativbildung zu stechen, in sich aufgenommen. das zeigt sich in dem eindringen starker flexion in das von hause aus schwache verbum, mag sie nun von stechen aus übernommen oder dem bedürfnis entsprungen sein, intransitiv- und transitivbildung durch starke und schwache flexion von einander zu scheiden (ebd. 1222, 1298, 1319; Heyne2 3, 771; Paul 2 522a). dieser vorgang konnte besonders auf ndd. boden leicht erfolgen, da hier die spröszlinge von stechen, von trans. und intrans.
I. in der weitaus häufigsten verwendung von verstecken als 'verbergen, verdecken, versperren' scheint eine fra-type mit einer faur-type aufgegangen zu sein: 'ein ding wegstecken, so dasz es nicht zu finden ist — vor einem dinge etwas vorstecken, so dasz es dem anblick dadurch entzogen wird'. in älterer sprache ist die grenze zwischen verbergen und verstecken häufig verwischt; heute ist verbergen allgemeiner. Adelung bevorzugt für verstecken 'in den meisten fällen in der edlern schreibart' verbergen, ebenfalls Campe, 'weil stecken schon unedler ist als bergen und verstecken mehr von kleinen dingen gebraucht wird, auch in uneigentlicher bedeutung nur in wenigen fällen gebraucht werden kann'.
C. im subst. part. prät. musz das reflexivum fortfallen:
3) ein intrans. ausdruck liegt vor oder zugrunde: versteckt sein, liegen, bleiben.
- verstehen
悟性的に理解する[GDJW]2 a) sich4〔von selbst〕∼ 自明の〈分り切った〉ことである:4 b)⦅unter et.3 et.4⦆(…を…と)理解する,解釈する: [GRIMM]I. verstehen als ausdruck für den vorgang des geistigen erfassens.
A. semasiologie, verbreitung, bedeutung.
4) verstehen berührt sich in der bedeutung mit fassen, begreifen, vernehmen. alle sind von sinnlichen auf geistige vorgänge übertragen. beim begreifen nimmt der geist die einzelnen theile oder merkmale des gegenstandes in sich auf und wird sich durch sie des ganzen bewuszt; beim verstehen kommt die form zum bewusztsein und das ganze in seinem zusammenhang und seiner ordnung Weigand syn. wb. nr. 561; begreifen ist noch etwas mehr als verstehen. man versteht nämlich viel sachen, die man doch nicht begreift. denn wer nicht völlig einsieht, wie es mit einer sache zugeht, oder wie sie möglich ist, der begreift sie nicht. jedermann versteht, was ich will, wenn ich sage: ein stein sey schwer; aber wie es mit der schwere zugehe, begreifen auch die weltweisen noch nicht vollkommen Gottsched beobachtungen über d. sprachgebrauch 407. die lebende sprache unterscheidet beim auffassen der rede vernehmen von verstehen; man vernimmt den sinnlichen, lautlichen klang des gesprochenen und gelangt dadurch, falls überhaupt die beziehung des klanges zum sinne klar ist, zum verstehen des in den lauten ausgedrückten sinnes vgl. Eberhard-Lyon nr. 1399. [/] verstehen als philosophischer kunstausdruck entspricht in der sprache der mystiker der bedeutung von verständnis (A 2), in der neueren philosophie der von verstand (A 2). es bezeichnet besonders das deutliche begriffs- und unterscheidungsvermögen: den underscheit (zwischen den beiden arten von gebresten) verstont! Tauler 126, 33 /Bd. 25, Sp. 1668/ Vetter. sobald wir von einem dinge deutliche gedanken oder begriffe haben, so verstehen wir es Chr. Wolff gedanken von gott 1, § 276; verstehen heiszt anfänglich den sinn oder die bedeutung der wörter und redensarten oder einer sprache überhaupt wahrnehmen Gottsched beobachtungen über d. sprachgebrauch 407; begriffe, durch welche allein der verstand etwas bei dem mannigfaltigen der anschauung verstehen d. h. ein object derselben denken kann Kant 3, 93 akad. ausg.; etwas verstehen, d. h. durch den verstand vermöge des begriffs erkennen oder concipieren 9, 65; daher drückt verstehen auch eine beziehung auf etwas aus, das uns ohne unser zuthun von auszen kommen soll Fichte 1, 234. man verstehet eine rede, ein wort, ein zeichen, wenn man eben den gedanken damit verknüpft, welchen der urheber der rede oder des zeichens damit verbindet Adelung; sich eine deutliche vorstellung von etwas machen Campe; die bedeutung, den sinn einer handlung, eines wortes, eines satzes, eines satzzusammenhanges erfassen, d. h. die den betreffenden sprachzeichen zugehörigen vorstellungen, begriffe, urteile mehr oder weniger deutlich, gegliedert, zusammenhängend reproduzieren oder reproduzieren können, auf grund von psychischen dispositionen und assimilationen, die das verständnis auch ohne deutliche vorstellungen ermöglichen Eisler philos. wb.3 3, 1672; wir verstehen nur vermittelst der übertragung unserer inneren erfahrung auf eine an sich tote äuszere thatsächlichkeit Dilthey einleitung i. d. geisteswissenschaften 1, 172.
3) ein intrans. ausdruck liegt vor oder zugrunde: versteckt sein, liegen, bleiben.
- vertauschen[GDJW]2⦅et.4 mit et.3(gegen et.4)⦆(…を…と)交換する,
取り替える: - verteilen[GDJW]1
分ける,分け与える,配る,分配する;(適当に)配分する,割り当てる,割り振る,分散させる;配置する: - vertreiben[GDJW]I 1⦅jn. / et.4⦆
追い出す,追い払う,駆逐する;放逐する,追放する;払いのける;取り除く,駆除する: - verursachen[GDJW]⦅et.4⦆(…の)原因となる,(…を)ひき起こす,惹起する,生ぜしめる:
- vervollständigen[GDJW](補足して)
完全なものにする,完備したものにする,完全にそろえる:再帰sich4~(欠けたところのない)完全なものになる,完全にそろう,完備する. - vervielfältigen複数化する[GDJW]
複写する,コピー〈プリント・リプリント〉する;複製する: [GRIMM]1) zahlenmäszig vermehren.
b) eine einheit zur mehrheit machen:
- verwandeln変換する,変更する[GDJW]2⦅jn. 〈et.4〉 in et.4 / et.4 zu et.3⦆(…を…に)変える,変化させる,変貌〈変身〉させる:
- verwechseln[GDJW]1⦅jn. 〈et.4〉 mit jm. / jn. 〈et.4〉 mit et.3⦆(…を…に)取り違える,
思い違える,混同する: - verweisen[GDJW]I1⦅jn. auf et.4⦆(…に…を)参照するように指示する:b)⦅jn. an jn.⦆(…に…のところへ)行くように指示する:
- verwerfen[GDJW]1 a)⦅et.4⦆(受け入れがたいもの・不適当なものとして)退ける,はねつける,拒否する,こばむ;〘法〙棄却(却下)する:ex. Er hat die Handlungsweise verworfen. 彼はその行状を〔不道徳であると〕
非難した. - verwirken[GDJW]2〘法〙(罪・過失などから処罰を)招く:
- verwirren[GDJW]I 1⦅et.4⦆
(糸などを)もつれさせる,(髪の毛を)くしゃくしゃにする;⦅比⦆紛糾〈混乱〉させる:再帰sich4 ~(糸などが)もつれる,(髪の毛が)くしゃくしゃになる;⦅比⦆紛糾する,混乱する| - verzehren[GDJW]1⦅et.4⦆
(飲食物を)〔すっかり〕食べる〈飲む〉,食べ〈飲み〉つくす,平らげる;(金・財産などを)費消する,遣い果たす: - vollbringen完成させる[GDJW](行為・仕事などを)
成し遂げる,成就する,遂行する: - vollenden[GDJW]I
完成する,完結〈完了〉する,仕上げる: [mhd. „zu vollem Ende bringen“] - vollführen完遂する[GDJW]
行う,実行する;成し遂げる,遂行する: - vollziehen[GDJW]1
実行する,遂行する;実施〈施行〉する;執行する: - vorangehen[GDJW]1 a)
先に立って行く,先頭を進む;⦅jm.⦆(…よりも)先に行く:b)(時間的に)先行する: - voranschicken先送りする
[GRIMM]
praemitto, v. schicken oder senden
- voraushaben[GDJW]⦅jm. 〈vor jm.〉 et.4⦆(…よりも…を)より多くもっている;(…よりも…において)まさっている:
- voraussetzen前提を設ける[GDJW]1(事物・事態などが)前提とする,前提条件として必要とする:
- voraussicken[GDJW]2⦅et.4⦆前置きとして〈前もって〉述べる,あらかじめ断っておく:
- vorbeigehen[GDJW]1 a)⦅an jm. 〈et.3〉⦆(…のかたわらを)通り過ぎる;〘スポーツ〙追い抜く;(銃弾などが)かすめる:
im〈beim〉Vorbeigehen通りすがりに;⦅比⦆片手間に: - vorbringen[GDJW]1前〈前方〉へもってゆく:
- vorfinden[GDJW]⦅jn. / et.4⦆目の前に(…があるのを)見いだす,
目のあたりに見る:(☞antreffen) - vorgehen[GDJW]I 4(ある状況下で)進行しつつある,
行われる,起こる,生起する,生じる: - vorhergehen[GDJW]I(vorangehen)(特に時間的に)先行する(ただし:vorher gehen 早めに行く).II現分形⦅付加語的⦆先行の,先の,前の;
事前の;前述(上述)の: - vorkommen前面に出てくる[GDJW]I 1
前方へ出てくる,前へ進み出る;(外へ)出てくる,現れ出る:3⦅場所を示す語句と⦆(…に)見られる,見出される,存在する;現れる,登場する: - vorlegen[GDJW]I 1 a)⦅jm. et.4⦆(…の)前に(…を)置く;
(…のために食物などを)皿にのせてやる:b)⦅〔jm.〕 et.4⦆(〔…に〕…を)呈示〈提示〉する,閲覧に供する;(書類・計画・法案などを)提出する;(成果などを)発表する,世に問う: - vorliegen[GDJW]2⦅jm.⦆(…の目の前・手もとなどに)ある,(…のところに)提出されている:
- vorschweben[GDJW]⦅jm.⦆(…の)念頭に浮かんでいる:
- vorsetzen故意による[GDJW]∇5(vornehmen)⦅sich3 et.4⦆(…しようと)
決心する;(…を)企てる,もくろむ:[GRIMM]17) besonders häufig mit reflexivem dat.
b) sich vorsetzen, 'eine zünftige handlung fest bey sich beschlieszen, durch welches fest es sich von vornehmen unterscheidet' Adelung; es liegt zwar in vorsetzen eine etwas stärkere energie als in vornehmen, aber der sprachgebrauch setzt sich über diesen unterschied hinweg, und so kann auch vorsetzen durch fest verstärkt werden:
- vorstellen[GDJW]5 a)⦅jm. et.4⦆(…に…を)
思い描かせる,(まざまざと)想像させる:表象させるb)再帰sich3 〈et.4〉 ∼…を心に思い描〈思い浮かべる〉,…を想像する;〘哲〙…を表象する| - vortragen講述する[GDJW]2⦅et.4⦆(人々の前で詩・散文などを)
朗読する;(演技・演奏などを)披露する,演じる,演奏する|(☞Vortrag)
W top
- wachsen[GDJW]I 1(人間・動植物の全体や部分が)育つ,大きくなる,伸びる,生長する,発育する;(植物が)生える,生育する,茂る;⦅比⦆(知恵・能力などが)伸びる,成長する:
- walten[GDJW]I㉂(h)⦅雅⦆
管理〈支配〉する,統治〈統轄〉する,(意のままに)処置する,切り回す;(力・精神などが)はたらいて(作用して)いる,幅をきかせている: [GRIMM]II. bedeutung und gebrauch. bei der ursprünglichen bedeutung 'die kraft für etwas, gewalt über etwas haben' ist es natürlich, dasz das verbum einer ergänzung bedarf.
2) walten mit präpositionellen bestimmungen, die die erstreckung der thätigkeit bezeichnen.
f) auch in etwas walten gehört z. th. hierher, in fällen wo die locale beziehung zurückgetreten ist z. b.:
4) besondere bedeutungen haben sich bei walten lassen entwickelt.
a) zunächst ist es 'machen dasz etwas herrscht oder geltung hat' (fälle dieser art sind z. th. schon oben eingereiht worden):
意のままにされる - wegdenken[GDJW]3(頭の中で)存在しないものとみなす,無視する:〔sich3〕 et4 ~ …はないものと考える:
- wegfallenなくなる[GDJW]
中止〈廃止〉になる;(語句などが)脱落する,省略される: - wegfangen[GDJW]ひっつかまえる,捕えて取り除く:水揚げする
- weglassen[GDJW]1省略する,
カットする;(うっかり)抜かす,落とす: - wegnehmen取り除く[GDJW]3⦅jm. et.4⦆(…から…を)取りあげる、奪う,没収する,持っていってしまう:
- wegrechnen[GRIMM]
abrechnen
(☞abrechnen) - weisen逃げ道を求める[GRIMM]
c) weisen an.
selten eigentlich; übertragen jemanden an jemanden oder etwas weisen 'hin-, verweisen an', ihn bewegen, sich an etwas oder jemanden zu wenden, um auskunft, rat, hilfe u. s. w. zu suchen: - weitläufig[GDJW]3 = weitschweifig
- weitschweifig[GDJW]非常に詳しい,委曲を尽くした;回りくどい,冗長〈冗漫〉な:
- wenden[GDJW]I 2 b)sich4 an jn. ~(依頼・質問・そのほかの要件で)…に相談〈依頼〉する,…に問い合わせる,…を頼る:(ex.) Dieses Buch wendet sich an Fachleute. この本は専門家を相手として書かれている.
敵対する2 c)再帰sich4 gegen jn. 〈et.4〉~…を相手どる,…と対抗する,…を攻撃する,…に反論する:[GRIMM] B.1.b)β)ββ) sich gegen jem. (etwas) wenden 'feindlich aggressiv zuwenden' u. dgl.
[GDJW]3⦅et.4 an et.4〈auf et.4〉⦆(金・時間・精力などを…に)ついやす,つぎ込む:
[GRIMM]B 1) b) β) ... εε) sich an etwas wenden 'sich um etwas kehren, kümmern' (s. auch unter A 2 b γ):
…となるよう心を砕く
γ) oft gleichbedeutend mit 'sich kehren, (windend) regen, bewegen, rühren' u. dgl.: - werden[GDJW]I 2 a)⦅zu et.3 〈jm.〉⦆(…に)なる:b)⦅aus et.3 〈jm.〉⦆(…から)生じる,
(…から)変じてできる: [PAUL]werdenEin Dat. kann zu w. hinzutreten: geworden ist ihm eine Herrscherseele Schi.: der urspr. Sinn von mir wird etw. ›etw. entsteht für mich, so daß es mein wird‹: es ist aber die Vorstellung des Übergehens in einen Besitz so in den Vordergrund getreten, daß auch solche Gegenstände als Subj. gesetz werden, die schon fertig vorhanden sind. Diese Ausdrucksform, verbunden mit einer durch zu angeknüpften Best. jetzt veralt.: das wurde ihm zum Lohn, Dank, zur Strafe, erhalten in zu Teil w. Ungew. mit zu und Inf.: was uns Armen kaum in Träumen zu sehen wird Wi. In anderen Verbindungen drückt der Dat. weniger Besiz als Interesse aus, und w. zu ist soviel wie ›gereichen zu‹: er wird uns zur Last.
(S. 1163l) acc. となって(が生じて) [zu] et. にまでにする(なる) - widerfahren(災いが)降りかかる[GDJW]⦅jm.⦆(…身に)起こる,
生じる;(…に)与えられる: [GRIMM] wi(e)derfahrenvb. , in älterer sprache 'zurückkehren, -gehen' und 'entgegengehen, -kommen, begegnen' (I). aus letzterer bedeutung entsteht im mhd. der übertragene gebrauch im sinne von 'geschehen, zuteil werden, begegnen, zustoszen' (II).
I. in konkreter bedeutung.
B. die bedeutung '(ent)gegen' läszt sich für das erste kompositionsglied von wi(e)derfahren seit. dem späteren ahd. nachweisen (s. u. unter 1).
1) 'entgegengehen, -kommen (auch zum kampfe), begegnen'. diese verwendung ist besonders im mhd. gut bezeugt; in dieser zeit hat sich auch der übertragene gebrauch aus ihr entwickelt (s. diesen unter II):
II. in übertragener verwendung, im anschlusz an I B 1.
A. etwas widerfährt.
3) abstraktes widerfährt, mit dativ der person oder sache. dies ist der herrschende gebrauch des wortes.
b) angenehmes, erwünschtes, günstiges wird zuteil:
c) unangenehmes, unerwünschtes, ungünstiges 'begegnet, geschieht, stöszt zu';
α) wiederholt bezeugte subjekte: / nur in belegen aus älterer sprache begegnen krankheit, spott, unfall, possen; z. b.:
- widersprechen[GDJW]2⦅et.3⦆(…と)矛盾する,(…と)
相いれない: - widerstreiten抗争する[GDJW]1⦅et.3⦆(…と)
対立する,衝突する: - widmen[GDJW]1 b)⦅et.3 et.4⦆(…に…を)ささげる,
(…のために時間・精力などを)費やす,割く:再帰sich4 et.3 ~ …に献身〈尽瘁〉する,…に専念〈没頭〉する,…に打ち込む - wiedererwerben再獲得する[GRIMM]
etwas verloren gegangenes von neuem erlangen;
- wiederherstellen原状回復する[GDJW]1⦅et.4⦆
元の状態に戻す,原状に復する,復旧〈復元・修復〉する: - wiederstehen再興する[GRIMM]
2) mit wieder- als erstem glied: reponere< i>widerstellen, refundere gantz widerstellen
c) 'in einen früheren (besseren) zustand zurückversetzen', 'wiederherstellen' (s. die belege unter wi(e)derstellung 2 c): - wirken実効がある,実効的に〔実効が上がり(を上げ)〕結果を出す[GDJW]2⦅しばしば様態を示す語句と⦆作用する,影響を与える;効き目がある,効果をもつ:
- wohlwollen[GDJW]I⦅jm.⦆(…に)好意をもっている,好意的である: (☞Wohl)
- wollen[GDJW]II⦅定型としてのみ用い,分詞や不定詞の形では用いない⦆⦅話し手のあまり信用していない主語の主張・言い分を示す;しばしば本動詞が完了形で⦆
…と主張する,…と言い張る,…と称する: - wuchern[GDJW]1(植物が)繁茂する,はびこる;〘生・医〙(組織が)増殖
〈増生〉する;⦅比⦆(病気など悪いものが)蔓延(流行)する,はびこる;(空想などが)ふくらむ: - wünschen待望する,待機する[GRIMM]II
A. der akt des verlangens nach etwas im eigenen oder fremden interesse oder das vorstellen einer sache als einer erstrebenswerten, und zwar stets in dem sinne, dasz die befriedigung des verlangens nicht vom eigenen bemühen abhängt.
6) im substantivierten infinitiv;
Z top
- zählen[GDJW]I 1数える,
勘定する: - zähmen[GDJW]1(動物を)飼い馴らす,調教する;(人間を)手なずける,押さえつける,おとなしくさせる;(自然力などを)制御する:
- zeigen明瞭になる[GDJW]II 1 b)(手ぶりなどで)指し示す,
(指し示して)教える:2 b)再帰sich4 ∼姿を見せる〈現す〉,現れる:4 a)再帰sich4 ∼ als et.1 〈∇et4.〉 ∼ 自分が…であることを実証する,…の態度をとる:b)再帰sich4 ∼明かになる,判明する:はっきりする,顕わにする - zerbrechen[GDJW]I壊す,
割る,破る,砕く,折る: - zerfallen[GDJW]1
崩壊する,崩れ落ちる;滅亡する;分解する;溶解する: - zerreißen破り棄てる[GDJW]I 1引き裂く,
引きちぎる,ずたずたにする,寸断する;(靴下などに)ほころび〈かぎ裂き〉を作る,穴をあける: - zerrütten[GDJW]
(健康を)ひどくそこねる,(精神を)錯乱させる;(秩序・体制・家庭・財政などを)破壊する,混乱に陥れる,ひどく乱す,台なしにする,めちゃめちゃにする:[GRIMM]überhaupt etwas geordnetes stören und in unordnung bringen, zunächst sinnlich:
- zerstören[GDJW]破壊する,
壊してしまう;だめにする,台なしにする,使用不能にする;(土地などを)荒廃させる: - zerstreuen[GDJW]I 1 a)
まき〈飛び〉散らす,分散〈拡散〉させる;散り散りにする,追い散らす,壊走させる: - ziehen[GDJW]I 1⦅空間的移動;ふつう方向を示す語句と⦆手などを持続的に接触させて一定の方向に移動させる:b)③⦅et.4 〔in et.4〕⦆引っぱり込む,
引き入れる;⦅jn. in et.4⦆(…に)巻き込む: - zugeben[GDJW]2(罪・失敗など不利なことをやむをえず)認める,
自白する: - zugehen[GDJW]非人称6⦅es geht zu⦆(様態を示す語句と)(…のように)
進行する,成り行く,生ずる,起こる: - zugehören[GDJW]⦅雅⦆(gehören)2⦅zu et.3⦆ (…に)付属する,
(…の)一部である: - zugrunde gehen根拠に行き着く(沈没する)[GDJW] zugrunde沈没する;
破滅(沈没)する: [GRIMM] GrundI. grund bezeichnet die feste untere begrenzung eines dinges. / A. grund von gewässern; seit ältester zeit belegbar:
4) in fester verbindung mit verben:
c) am entwickeltsten ist zu grunde.
β) unter den intransitiven wendungen dominiert zu grunde gehen. mhd. noch selten, erst im 16. jh. reich entwickelt; ursprüngliche bedeutung 'im wasser untersinken':
indessen ist der ursprüngliche sinn der wendung früh zurückgetreten zu gunsten der bedeutung des verderbens, untergehens, die im 16. jh. ursprünglich an die wendung zu boden (d. h. auf den erdboden) gehen geknüpft ist (vgl. DWB boden 5, th. 2, 212); zu gr. gehen hat im 18. jh. das erbe dieser formel angetreten, nachdem es lange in concurrenz mit ihr gelegen; daher auch die doppelwendung zu gr. und boden gehn, worüber unter II C 2 genaueres. die ablösung vollzieht sich auf breiterer front, ähnlich auch bei zu gr. richten, stürzen u. ä. (s. II B 1), zu welchen wendungen zu gr. gehen seit dem 16. jh. das intransitive gegenstück bildet.
IV. die zukunftsvollste bedeutung, die erst in jüngerer sprache aufs reichste entwickelt wurde, ist 'basis, fundament'.
A. grund 'fundament, basis' ist ahd. nicht nachgewiesen, mit dem 13. jh. werden die belege häufiger;
3) in den weitaus meisten fällen steht grund 'fundament' in festen verbalverbindungen.
c) zum (zu) grunde legen gewinnt erst mit dem 18. jh. boden; ältere belege vereinzelt:
β) das 19. jh. schuf ein subst. zugrundelegung, das in der gelehrten- und amtssprache lebhaft gewuchert hat: wenn bei diplomatischen unterhandlungen es vorkäme, dasz der eine theil die zugrundelegung seiner proposition ... gefordert hätte Hegel 16, 349;
namentlich mit präpositionen: Kant hat ... unter zugrundlegung des schemas der kategorien vier antinomien herausgebracht Hegel 6, 104;
(☞Grund) - zugrunde liegen根拠のもとにある[GRIMM] Grund
II. 'erdboden', neben 'meeresboden' u. ä. der andere grosze bedeutungsstrang des subst., für den ursprünglich das feminine geschlecht anzusetzen ist (s. o. form 1); die bedeutung ist, verschieden variiert, ags., anord. und ahd. bezeugt; indessen bis ins spätmhd. merkwürdig selten; doch heute ebenso in hd. wie in nd. maa. die art des bedeutungszusammenhangs mit I ist unerkennbar. wenn von I abgespalten, vielleicht zu verstehen als das unterste, die feste grundlage von allem, was sich dem auge darbietet.
B. präpositionale wendungen.
2) zu grunde als prädicative bestimmung neben intrans. verben; zu sondern von zu grunde sinken, gehen u. ä. (s. o. I A 4 c β) und weit weniger entwickelt als jenes:
voll entwickelt nur zu grunde liegen 'am boden liegen', dann 'darnieder liegen, verdorben sein':
- zukommen[GDJW]3 a)⦅jm.⦆(…に)
当然与えられる,帰属するのが当然である,(…が)当然受けるべきである;(…に)ふさわしい,似つかわしい:b)⦅et.3⦆(…に重要性などが)〔属性として〕ある,付随する: - zulassen[GDJW]1⦅et.4⦆(…を)許す,許容する,認める;(…を)妨げない,(…の)余地を残す:
- zureichen[GDJW]II⦅話⦆(ausreichen)
足りる,十分である: - zurückbekommen[GDJW](失ったもの・〔貸し〕与えたものなどを)
返してもらう,取り戻す,再び手に入れる: - zurückbiegen[GDJW]
後ろへ曲げる,反らす,曲げ戻す: - zurückbleien[GDJW]1 b)(前に出ないで)後ろに留まっている:
- zurückblicken[GDJW]1後ろを振り返〔って見〕る:(☞zurücksehen)
- zurückerhalten(☞zurückbekommen)
- zurückfallen[GDJW]2⦅in. et.4⦆(元の悪い状態に)
再び落ち込む(陥る),逆戻りする: - zurückführen復帰させる[GDJW]I 1(元の場所へ)導き戻す,
連れ〈運び〉戻す,返送〈送還〉する:2⦅et.4 auf et.4⦆(…を…に)戻す,還元する;(…〔の起源・原因〕を…に)帰する; - zurückgehen戻って行く[GDJW]1 a)(元の場所へ)
帰る,戻る,あと戻りする,引き返す;⦅話⦆帰郷(帰国)する;(元の職場に)復帰する:ex) Er ging denselben Weg zurück. 彼は来たのと同じ道を戻っていった。 - zurückkehren還帰する[GDJW]1⦅雅⦆
帰る、戻る、帰還する: - zurücklegen[GDJW]3(道のりを)あとにする,進む:
- zurückliegen[GDJW]1後ろ〈背後〉にある。:
- zurückkommen[GDJW]1
帰ってくる,戻ってくる:(ex.) aus dem Urlaub 〈von der Reise〉~ 休暇〈旅行〉から戻ってくる。 - zurücknehmen[GDJW]1(一度渡したり与えたりしたものを)再び取り戻す;
(売った品を)再び引き取る:3(発言・約束・申し出などを)撤回する,取り消す: - zurücksehen[GDJW]=zurückblicken
- zurücksetzen[GDJW]4⦅jn.⦆(他人よりも)不利に扱う,冷遇する
- zurückstehen問題が残されている[GDJW]1後方に立って〈退いて〉いる.2
⦅比⦆⦅hinter jm. <et.4⦆(…よりも)劣っている,(…に)負けている;(…よりも)不利な立場にある:[GRIMM]2) von dingen, die noch zu thun bleiben:
- zurückstoßen[GDJW]I突き戻す,突き返す;後方へ突く(けとばす)(☞repelliren, abstoßen)
- zurücktreten[GDJW]1 a)後ろへさがる,後方へ退く,後退する,後ずさりする:
- zurückziehen引き戻す[GDJW]I 4再帰sich4 ~ 後ろ〈後方・元の場所〉へ引きさがる;(奧のほうへ)引っ込む;(部屋などに)引きこもる;(軍隊などが)撤退〈退却〉する;⦅比⦆(第一線から)退く;隠遁する(→zurückgezogen II):
- zusammenbinden[GDJW]
結び〈縛り・くくり〉合わせる,束ねる: - zusammenbringen[GDJW]3⦅話⦆つなぎ合わせる,組み立てる;
(記憶によって言葉を)つづる: - zusammenfallen崩落する[GDJW]5
一か所に集合する,(川などが)合流する:[GRIMM]von räumlicher und persönlicher vereinigung:〔…〕alles dies nicht mehr üblich. auf einen punkt z.
:
[DUDEN]2an Umfang verlieren, gänzlich in sich einsinken (2) / Beispiele: der Ballon, der Teig ist zusammengefallen / 〈in übertragener Bedeutung〉: Pläne fallen in sich zusammen (erweisen sich als unrealisierbar)
- zusammenfassen一括する[GDJW]1
統合〈統一〉する,まとめる: - zusammengehen[GDJW]1(線などが)一緒になる,交わる:
- zusammenhalten[GDJW]II 1
ばらばらにならないようにする,まとめる,結び合わせる,束ねる: - zusammenhängen[GDJW]I⦅mit et.3⦆(…と)
結びついて〈くっついて〉いる,つながっている: - zusammenknüpfen[GDJW]I結び合わせる:
- zusammennehmen[GDJW]1 a)
一緒にする,集める,ひとまとめにする;総合する,総括する;(考えなどを)集中する;(勇気などを)奮い起こす: - zusammenschließen[GDJW]3⦅jn. / et.4⦆(錠・鎖などで)つなぐ:
- zusammensetzen[GDJW]1 a)
組み立て〔て作り上げ〕る,構成する;,(語などを)合成する;(混合液などを)調合する: - zusammenstellen[GDJW]2 b)⦅比⦆
(うまく)組み合わせる;編成〈構成〉する,作成する;まとめ上げる: - zusammentreffen一緒になる[GDJW]2⦅比⦆(時間的に)
ぶつかる,重なり合う;(内容的に)一致〈合致〉する: - zuschlagen[GDJW]II 2 a)殴りかかる,
打ってかかる;⦅比⦆攻撃〈痛打〉を加える: - zuschreiben[GDJW]1⦅jm. 〈et.3〉 et.4⦆(…を…に)帰する,
(…に…の)責任を負わせる: - zusehen[GDJW]1⦅jm. / et.3⦆(…の様子をわきから)眺める,見物する;傍観する:
[GRIMM]
2) z. bezeichnet die innere betheiligung an dem gegenstand des sehens, 'gegenwärtig sein und sehen' Adelung. bes. in neuerer zeit gerne an mit angeschlossen, s. den beleg aus Göthe bei a, aus K. Scheidt bei b. darauf beruht auch der unterschied von ansehen.
a) einem vorgange z., der dadurch zum schauspiel wird: ich wünsche mir oft aus deinem fenster dem schönen erd- und wolkenspiel mit zuzusehen Göthe IV 20, 17 W.
b) der vorgang wird nur angedeutet: Antonius hat solchs gethon [/] und vil volcks mit zůsehen lon [/] K. Scheidt Grobianus v. 1001;
d) einer person z., sie bei ihrem thun beobachten: wenn ich ihnen (den kindern) zusehe und in dem kleinen dinge die keime aller tugenden, aller kräfte sehe, die sie einmal so nöthig brauchen werden Göthe 19, 41 W.;
3) wer zusieht, handelt selbst nicht, so wendet sich zusehen mehr und mehr nach der negativen seite.
a) zusehen im gegensatz zum handeln:
c) unthätig einem vorgang z., ihn ertragen und nicht hindern können: ich weisz es, der ich diesem irrsal seit mehr als zwanzig jahren zusehe Göthe IV 37, 189 W.;
d) zeitlich befristet wird das z. zum abwarten: ich danke für den beytrag zur auslegung des mährchens, wir würden freilich noch ein bischen z. Göthe IV 10, 355 W.
- zuspitzen[GDJW]2(事態を)
切迫〈先鋭化〉させる : - zustimmen[GDJW]⦅jm. / et.3⦆(…に)同意する、
賛意を表する,賛成〈賛同〉する: - zuteilen[GDJW]2⦅jn. et.3⦆(…を…に)配属する,
配置する:
- zählen[GDJW]I 1数える,